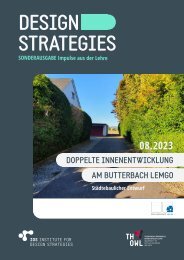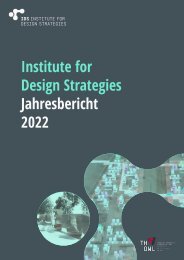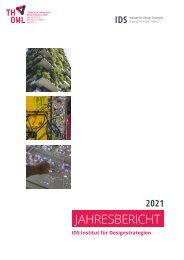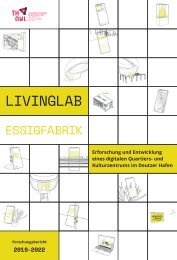urbanLab Magazin IMPULSE 08/2020 - Heimatwerker*innen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In einer urbanisierten Welt werden die Weichen<br />
136<br />
für die Zukunft in den Städten gestellt. Gesellschaftliche<br />
Veränderungen gerade in der „freien“<br />
Welt nehmen hier ihren Start. So auch in Deutschland.<br />
Vor diesem Hintergrund stehen viele deutsche<br />
Städte vor enormen gesellschaftlichen und<br />
städtebaulichen Herausforderungen, die Hand in<br />
Hand gehen. Nicht selten werden diese missinterpretiert,<br />
denn schuld an benachteiligten Stadtteilen<br />
sind nicht die Geflüchteten von 2015/16 oder<br />
andere Zuwanderer, sondern über 50 Jahre versäumte<br />
Investitionen in das soziale Kapital der<br />
Städte. Die neoliberale Hinwendung vieler Städte<br />
zur Akkumulation globalen Finanzkapitals beinhaltete<br />
automatisch die Abwendung von Investitionen<br />
in urbanes Sozialkapital (Harvey, 2007).<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Dort wo der Strukturwandel am heftigsten traf,<br />
hat die Ummünzung von Arbeitern in Kleinkapitalisten<br />
durch die freien Marktmechanismen versagt.<br />
Mangels sozialem Invest konnte hier auch<br />
kein finanzielles Kapital produziert werden.<br />
Keynesiansche Sonderprogramme wie etwa die<br />
„Soziale Stadt“ oder „Investitionspakt soziale<br />
Integration im Quartier“ versuchen hier zu unterstützen,<br />
sind aber oft räumlich und zeitlich<br />
zu begrenzt, um tatsächliche strukturelle Änderungen<br />
zu bewirken. So stellt sich die Frage,<br />
ob und wie man mit begrenzten Mitteln und oft<br />
durch informelle Planung und zivilem Engagement<br />
lokale Potentiale im Stadtteil durch die<br />
Aktivierung und Emanzipierung von Migranten<br />
und Flüchtlingen wecken kann, um gesellschaftliche<br />
Strukturen „von unten“ aufzubrechen.<br />
In der Praxis<br />
Die Basis der Feldarbeit bildet ein Mailing an alle<br />
deutschen Städte über 30.000 Einwohner mit<br />
der freundlichen Bitte, an einer Online-Umfrage<br />
teilzunehmen, sofern sie ein Projekt haben, dass<br />
Stadtentwicklung mit der Integration von Migranten/Flüchtlingen<br />
verbindet. Von knapp 400 Mailings<br />
wurden etwa 40% mit 1<strong>08</strong> negativen, aber<br />
auch 35 positiven Rückmeldungen beantwortet,<br />
zu welchen auch der Online-Fragebogen ausgefüllt<br />
wurde. Dreizehn der Projekte habe ich<br />
im Frühjahr 2019 besucht und mit persönlichen<br />
Experteninterviews vertiefend untersucht. Die<br />
Ergebnisse haben wiederum neue Perspektiven<br />
geliefert, welche weiteres Literaturstudium erfordern.<br />
Insofern ist alles weitere noch spekulativ.<br />
Hier dennoch ein kurzer Zwischenstand:<br />
Die meisten Absagen lieferten keine weiteren inhaltlichen<br />
Erkenntnisse, obwohl sich viele an der<br />
Thematik interessiert zeigten. Allerdings ließen<br />
auch einige der Rückmeldungen auf ein Unverständnis<br />
zum Zusammenhang von Migration und<br />
Planung schließen. Weiterhin stand für viele Städte<br />
die funktionale Not der Unterbringung und<br />
Erstversorgung im Vordergrund. Manche Städte<br />
hakten damit dann auch das Thema planerisch<br />
ab: Es wäre dann „schnell in den Bereich Soziales<br />
übergegangen.“ Oder es wurde daraus „die übliche<br />
Integrationsarbeit…“.<br />
Man kann ableiten, dass viele Städte keine Ressourcen<br />
für eine genauere Betrachtung haben<br />
oder sich der Zusammenhang zwischen Planung<br />
und Immigranten bestenfalls fragmentarisch erschließt.<br />
Das hat neben Ressourcenmangel aber auch mit<br />
Strukturen zu tun, in der Verwaltung und im Kopf.<br />
Verwaltungen arbeiten preußisch funktional und<br />
linear. Querdenken, Engagement und Verantwortung<br />
über die eigene Zuständigkeit hinaus zu<br />
übernehmen zählen selten zu den Einstellungsvoraussetzungen.<br />
Doch „bösartige Probleme“ (Rittel<br />
& Webber, 1973) lassen sich nicht konventionell<br />
lösen. Sie nehmen wenig Rücksicht auf lineare<br />
Verwaltungsstrukturen und bedürfen stattdessen<br />
einer übergreifenden Herangehensweise, die in<br />
öffentlichen Strukturen neu und selten ist. Noch<br />
seltener ist es, dass aus den Ansätzen auch tatsächlich<br />
Projekte entstehen. Aber es gibt sie.<br />
Die rückgemeldeten Projekte weisen eine große<br />
Bandbreite auf. Manche fallen in den Bereich<br />
Planung, andere in den Bereich Soziales, aber die<br />
meisten entspringen tatsächlich ressortübergreifenden<br />
Ansätzen. Es ist alles vertreten, von großstädtischen<br />
integrierten Stadtentwicklungskonzepten<br />
über Quartiersprojekte privater Stiftungen<br />
bis hin zum gemeinschaftlichen Umbau eines<br />
Ackerbürgerhauses mit und für die Nutzung von<br />
Flüchtlingen (siehe hierzu auch Beitrag Prof. Oliver<br />
Hall). Diese Vielfalt erschwert zwar die Auswertung,<br />
ist aber bereits ein Ergebnis:<br />
Die Arbeit mit Migranten passt in keine Schublade.<br />
Sie findet überall statt, im Großen wie im<br />
Kleinen, im Öffentlichen wie im Privaten.<br />
Die Rückmeldungen lassen bestimmte Schlüsselfaktoren<br />
erkennen, die ich hier nur als vorläufige<br />
Stichpunkte aufführen kann. Diese und andere Aspekte<br />
aus meiner Feldarbeit werde ich in meiner<br />
Dissertation natürlich vertieft diskutieren.<br />
Die Untersuchung bestätigt einen klaren Zusammenhang<br />
zwischen ethnischer Vielfalt und schlechterem<br />
städtischem Umfeld:<br />
Je mehr Zuwanderer, auch inzwischen „einheimi-