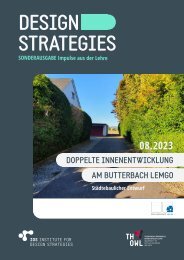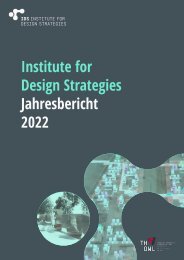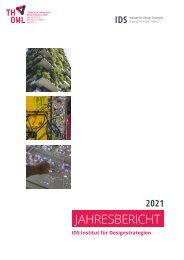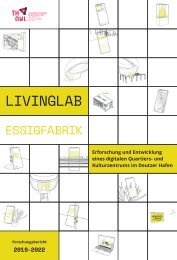urbanLab Magazin IMPULSE 08/2020 - Heimatwerker*innen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sche“ Zuwanderer, desto schlechter sind die urbanen<br />
Lebensbedingungen.<br />
Aber zugezogene Migranten sind, wie oben bereits<br />
dargestellt, nicht die Ursache benachteiligter<br />
Stadtteile, sondern ihre Opfer, die mangels<br />
finanzieller Freiheiten sich nichts anderes leisten<br />
können. Diese Ankunftsstadteile wird es immer<br />
geben aber sie dürfen nicht in einen strukturellen<br />
Benachteiligungsstrudel geraten. Sie sollten eine<br />
Schleusenfunktion zur gleichberechtigten Aufnahme<br />
in die Gesellschaft bieten. Dies bedarf neben<br />
einer durchmischten Bevölkerung einer angemessenen<br />
Investition in soziales Kapital, Bildung und<br />
Existenzgründung, ohne dadurch Gentrifizierung<br />
auszulösen. Die notwendigen Netzwerke ethnischer<br />
Gruppen sind keine feindliche Mobilisierung,<br />
sondern als Orientierungshilfe Schlüssel<br />
der Vergesellschaftung. Vielfalt schwächt nicht die<br />
urbane Gesellschaft, sondern stärkt sie und gibt<br />
Impulse, sich in einer verändernden Welt besser<br />
zu behaupten.<br />
Vertrauen ist die grundlegende Herausforderung<br />
für die Aktivierung sozialen Kapitals, sowohl bei<br />
Zugezogenen als auch bei Einheimischen.<br />
Viele, die vor langer Zeit zugezogen sind, fühlen<br />
sich nicht angesprochen, wenn es um Stadtteilentwicklung<br />
geht. Man erreicht vielleicht wenige<br />
Sprecher, aber nicht die Menschen dahinter – ein<br />
deutliches Zeichen von Segregation. Jahrzehnte<br />
benachteiligt und sich selbst überlassen, fehlt<br />
die Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft<br />
und die Bereitschaft für Engagement. Neuzugereiste<br />
haben schlicht dringlichere Prioritäten wie<br />
Asylverfahren, Sprachkurse, Arbeitssuche, Familienlogistik,<br />
etc., um sich gedanklich auf langfristige<br />
Planungsprojekte einzustellen. Das Vertrauen<br />
in staatliche Machtstrukturen ist meist gering,<br />
schließlich waren diese oft genug Fluchtursache.<br />
Verwaltungen brauchen mehr „Bodenhaftung“ im<br />
Quartier, um Bedarfe zu erkennen. Quartiersmanager,<br />
Botschafter und andere lokale Mittler zwischen<br />
Bedarfen und Möglichkeiten sind hierfür<br />
gut geeignet.<br />
Integration suggeriert Assimilation, aber das Gegenteil<br />
erscheint nötig: Emanzipation.<br />
Zugezogene sind im Schnitt motivierter als Einheimische<br />
und wollen mit den ihnen gegebenen<br />
Möglichkeiten etwas erreichen. Die aktuelle Debatte<br />
betrachtet Integration als Mittel zur möglichst<br />
schnellen Verdeutschung internationaler Vielfalt.<br />
Nicht ausreichend im Fokus stehen die Anerkennung<br />
und Emanzipation von Immigranten und Geflüchteten<br />
als integrale Bestandteile der städtischen Gesellschaft.<br />
Ebenso bedarf es nicht nur einer kulturellen<br />
Öffnung der Behörden, sondern der deutschen<br />
Gesellschaft hin zur Vielfalt. Der Schwerpunkt einer<br />
gesellschaftlichen Identität kann sich bei einer Bevölkerung<br />
mit 25% Migrationshintergrund und 40%<br />
bei Kindern unmöglich um „Verdeutschung“ drehen.<br />
Es ist Zeit, sich zusammenzusetzen und eine gemeinsame<br />
Identitätsdebatte zu beginnen, die zu<br />
einer Innovation des gesellschaftlichen Selbstverständnisses<br />
führt.<br />
Hier sind nicht nur staatliche Institutionen gefragt,<br />
sondern die Köpfe und Herzen aller Deutschen.<br />
Das ist weder einfach noch schnell zu erreichen.<br />
Die Kunst ist es, auf eine neue Situation nicht<br />
mit Rückzug, Feindseligkeit oder Arroganz zu reagieren,<br />
sondern mit Interesse und Forschergeist<br />
(El-Mafaalani, 2018: 91).<br />
Die Zeit präskriptiver Planung ist vorbei.<br />
Der Technokrat, der aus seinem administrativen<br />
Elfenbeinturm heraus weiß, was gut und richtig für<br />
den Stadtteil ist, ist ein Auslaufmodell. Öffentliche<br />
Bekanntmachungen haben nichts mit Partizipation<br />
zu tun (siehe hierzu Arnsteins Leiter der Partizipation,<br />
1969). Städtebauliche Wettbewerbe sind ein<br />
Ansatz, aber das Plenum meist elitär besetzt, ohne<br />
ausreichende Stimme aus dem Stadtteil. Governance<br />
und deliberative Demokratie, ob durch kommunale<br />
oder private Stiftungen Institutionen initiiert<br />
zeigen experimentelle Ansätze, die es auszubauen<br />
gilt. Versagt der Neoliberalismus aufgrund seiner<br />
Struktur und finanzkapitalistischen Ausrichtung in<br />
der Planung (siehe Gunder, 2010), oder schafft er<br />
dadurch auch einen Freiraum, der es ermöglicht<br />
kooperative Planungsarbeit „von unten“ zu bilden,<br />
mit welcher das soziale Kapital der Stadt informell<br />
zurückerobert werden kann (siehe Lefebvre, 2013;<br />
Harvey, 2013; Sandercock, 1998; 2003)?<br />
In diesem Zusammenhang gilt es die Crux der Bürokratie<br />
zu lösen. Die Herausforderungen einer<br />
zunehmend vielfältigen Gesellschaft sind komplex<br />
und können nicht in funktionalen Fachbereichen<br />
abgearbeitet werden, die optimale Lösungen produzieren.<br />
Um das Vertrauen in die Verwaltung nicht<br />
zu verlieren, muss sich die Verwaltung öffnen. Der<br />
Schlüssel zur Bewältigung liegt nicht nur in ressortübergreifendem<br />
Denken und Handeln, sondern<br />
auch in der Fusion öffentlicher und privater Initiativen.<br />
Städtische Gesellschaften, unabhängige<br />
Stabstellen in der Verwaltung und öffentlich-private<br />
Partnerschaften ermöglichen übergreifendes<br />
Denken und schnelleres Handeln. Hierfür sollten<br />
neue Lösungsansätze gefunden werden, welche<br />
die Vorteile beider Strukturen nutzen.<br />
137<br />
ZUSAMMENFASSUNG