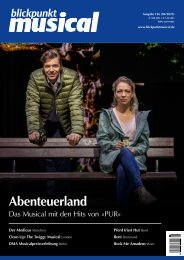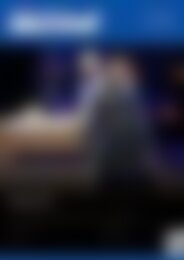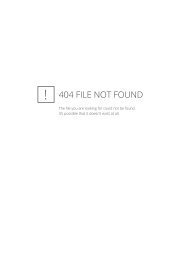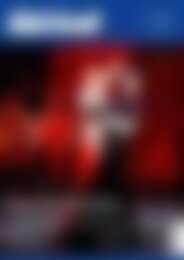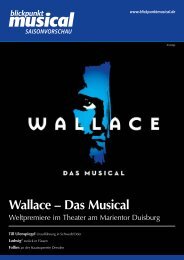Blickpunkt Musical 02-23 - Ausgabe 122
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Musical</strong>s in Deutschland<br />
Stimmen der Straßen Berlins<br />
»Berlin: Die 1920er Jahre – eine Stadt im Taumel« in der Wabe Berlin<br />
Abb. oben von links:<br />
1. Chansonsängerin Sigrid<br />
Grajek ist auf 20er Jahre Programme<br />
spezialisiert<br />
2. Sigrid Grajek in ihrem Element<br />
Fotos (2): Dorothea Tuch<br />
Berlin: Die 1920er Jahre –<br />
eine Stadt im Taumel<br />
Diverse / Sigrid Grajek<br />
Die Wabe Berlin<br />
Uraufführung: 29. Januar 2<strong>02</strong>3<br />
Gesang: Sigrid Grajek<br />
Piano: Stefanie Rediske<br />
Die 1920er Jahre werden gern in Revuen dargestellt.<br />
War die Kunstform doch damals besonders in Mode.<br />
Sigrid Grajek bezeichnet ihren Abend, den sie 2<strong>02</strong>0 konzipierte,<br />
als »musikalisch-literarische Collage«. Die Verschmelzung<br />
beider Gattungen blickt tief ins Wesen der<br />
Zeit. Da sind heitere Momente, die Not, die Politik, die<br />
Satire, die Neue Sachlichkeit, die Sehnsucht. Alles steckt<br />
drin in den 21 Songs und 14 Texten. Das Herausragende<br />
an der Show ist, dass Lieder und Literatur großer Namen<br />
dabei sind: Friedrich Hollaender, Kurt Tucholsky, Erich<br />
Kästner und Rudolph Nelson, aber Titel gewählt wurden,<br />
über die sonst hinweg gesehen wird. Grajek bringt sie den<br />
Zuschauenden mit ihrer Pianistin Stefanie Rediske nahe.<br />
Dazwischen sind Namen, die selten in Revuen auftauchen,<br />
wie Oskar Kanehl, Otto Stransky und Erich Einegg.<br />
Sind deren Arbeiten seit ihrer Entstehung in den 1920er<br />
Jahren gehört worden? Es wird deutlich, Grajek kennt sich<br />
aus mit der Materie. Zum Glück ist das mit ihrem Talent<br />
gepaart, die Erzählungen, welche wie Schlüssellöcher in<br />
die Vergangenheit blicken lassen, lebendig und unterhaltsam<br />
zu vergegenwärtigen. Spannend wird’s, wenn’s klingt,<br />
als sei’s gerade heute erst geschrieben worden. Auffällig ist,<br />
dass viele Geschichten im Straßenmilieu spielen.<br />
Die Epoche wird chronologisch aufgerollt. Den Einstieg<br />
macht Klabunds Gedicht ›Berliner Weihnacht 1918‹<br />
mit einem rollenden Rhythmus: »Am Kurfürstendamm<br />
da hocken zusamm’ / die Leute von heute mit großem<br />
Tamtam. Brillanten mit Tanten, ein Frack mit was drin«.<br />
Später heißt es: »Am Wedding ist’s totenstill und dunkel./<br />
Keines Baumes Gefunkel, keines Traumes Gefunkel.«<br />
sowie: »Es schneit, es stürmt. Eine Stimme schreit: Halt./<br />
Über die Dächer türmt eine dunkle Gestalt.«<br />
Ein düsterer Auftakt – er holt die Entbehrungen der<br />
Nachkriegszeit und die tobende Revolution dicht heran.<br />
Dem folgt im wahrsten Sinn des Wortes ein Tempowechsel<br />
mit Walter Mehring und Friedrich Hollaenders Klassiker<br />
›Berliner Tempo‹, das nur ein Jahr später entstand:<br />
»Die Linden lang! Galopp! Galopp!/ Zu Fuß, zu Pferd, zu<br />
zweit!/ Mit der Uhr in der Hand, mit’m Hut auf’m Kopp./<br />
Keine Zeit! Keine Zeit! Keine Zeit!«<br />
Die Politik hält in den frühen Jahren Einzug mit<br />
dem Tod von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg,<br />
der Dolchstoß-Legende und dem Marsch ›Auf, auf zum<br />
Kampf‹. Zum Denken regt Hollaenders beißende Satire<br />
›Wir wollen alle wieder Kinder sein‹ an, das mit einer<br />
trügerisch heiteren Melodie Deutschlands Verhältnis zum<br />
Krieg aufgreift. Mit der Figur der ›Mignon vom Kiez‹ skizziert<br />
Hollaender einen anderen Teil der Gesellschaft: eine<br />
Arbeitergöre, die in ganz unschuldiger Manier von ihrer<br />
Freundin erzählt, die beim Tanz ist, und von ihrer Schwester,<br />
die als Komparsin arbeitet. Nach »wat Schönem« sehnt<br />
sie sich.<br />
Grajek nimmt die Lieder auch zum Anlass, ihren<br />
gesellschaftlichen Kontext darzustellen. So geht sie auf<br />
den Film »Anders als die anderen« ein. Er ist historisch<br />
bedeutsam, da er im Zuge von Aufklärungsfilmen erstmals<br />
Homosexualität bei Männern aufgreift. Wenig später<br />
war dies nicht mehr möglich. Dies dient als Überleitung<br />
zu ›Das lila Lied‹, worin es stolz heißt: »Wir sind nur einmal<br />
anders als die anderen« – Homosexualität wird dort in<br />
einer Hymne gefeiert.<br />
Grajek trägt den Song mit viel Würde vor. Ihr androgynes<br />
Auftreten mit Hose, Hemd und Weste erleichtert<br />
ihr den Wandel zwischen Mann und Frau und den vielen<br />
Figuren, die sie heraufbeschwört. Überhaupt meint<br />
man, zuweilen zu spüren, wie der Zeitgeist durch sie<br />
hindurchdringt.<br />
Einen Höhepunkt bildet Tucholskys ›Ein deutsches<br />
Volkslied‹, das Grajek herrlich über die Rampe bringt:<br />
Zum einen den Professor, der über den Schlager ›Wir<br />
versaufen uns’rer Oma ihr klein Häuschen‹ referiert, zum<br />
anderen den Titel selbst, den der damalige Star des Metropol-Theaters<br />
Robert Steidl sang und damit die Inflation<br />
der Jahre satirisch festhielt.<br />
Des weiteren erfreut man sich an Entdeckungen wie<br />
Willy Rosens ›Miese Zeiten‹ und Hits wie ›Es liegt in der<br />
Luft‹ und ›Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben‹<br />
sowie an den gespenstisch aktuellen Worten von Erich<br />
Kästners ›Große Zeiten‹.<br />
Grajeks reichhaltiges Programm umfasst nicht nur<br />
inhaltlich ein weites Spektrum, sondern auch musikalisch:<br />
Operette, Schlager, Gassenhauer, politisches Lied, Chanson<br />
etc. Der unterhaltsame und informative Abend in<br />
Taschenformat ist eine Bereicherung.<br />
Sabine Scherek<br />
36<br />
blickpunkt musical <strong>02</strong>/2<strong>02</strong>3