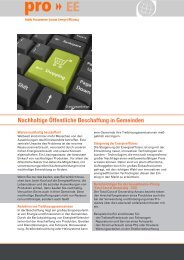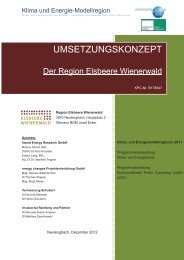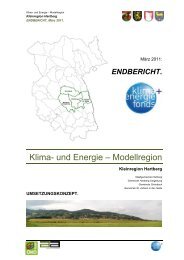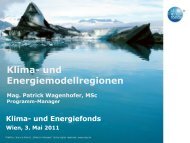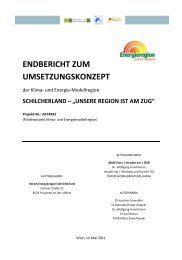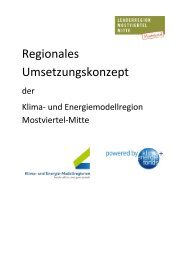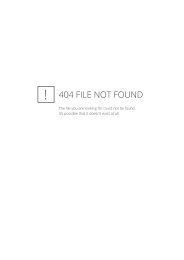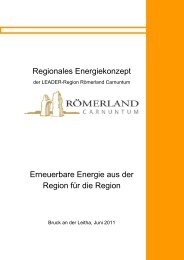Umsetzungskonzept - Übersichtskarte der Klima- und Energie ...
Umsetzungskonzept - Übersichtskarte der Klima- und Energie ...
Umsetzungskonzept - Übersichtskarte der Klima- und Energie ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.3.10 Potential Erdwärme<br />
Gr<strong>und</strong>legendes:<br />
Zum Einsatz von Erdwärme (Geothermie) gibt es 2 Bereiche.<br />
Tiefengeothermie, welche den Wärmefluss aus dem Erdinneren nutzt<br />
<strong>und</strong> Wärmepumpen, welche die Wärme aus den maximal obersten 100<br />
m (meist nur wenige m Tiefe) nutzen. Bei dieser zweiten Variante<br />
stammt die Wärme von <strong>der</strong> Sonneneinstrahlung, wobei das Erdreich zu<br />
den Lufttemperaturen im Temperaturverlauf etwa 6 Monate nachhinkt,<br />
<strong>und</strong> daher im Winter Wärme liefern kann. Indirekt kann eine<br />
Wärmpumpe die Umgebungswärme aus dem Gr<strong>und</strong>wasserstrom<br />
entziehen o<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Luft. Wärmepumpen benötigen einen<br />
zusätzlichen <strong>Energie</strong>träger, um genügend hohe Temperaturen (meist<br />
40-60°C) zu erzeugen. Bei Tiefengeothermie werden höhere<br />
Temperaturen erschlossen, diese können über 100°C betragen <strong>und</strong><br />
sind dann auch für eine Stromerzeugung (ORC-Prozess) kombiniert<br />
mit Wärmenutzung von Interesse.<br />
Abb. 41: Erdwärme - Tiefenbohrung<br />
Tiefengeothermische Nutzung ist anhand <strong>der</strong> geologischen Struktur des Kristallins als ungünstig<br />
zu bewerten. Je 125 m Tiefe steigt in <strong>der</strong> KEM ASTEG die Temperatur um 1°C. Weiters ist das<br />
Bohren in kristallinen <strong>und</strong> metamorphen Gesteinen nur sehr schwer in größere Tiefen durchführbar<br />
<strong>und</strong> daher auch sehr teuer. Lokale positive Anomalien könnten entlang von Bruchzonen möglich<br />
sein. Aus <strong>der</strong> nachfolgenden Tabelle zeigt sich kein nutzbares Potential in <strong>der</strong> KEM ASTEG.<br />
Tab. 90: Temperaturverlauf nach Bohrungstiefe – KEM ASTEG<br />
Wärmepumpen<br />
Das theoretische Potential errechnet sich aus <strong>der</strong> Fläche des betrachteten Gebiets <strong>und</strong> dem<br />
durchschnittlich erzielbaren <strong>Energie</strong>ertrag pro m². ASTEG wird mit 20 W/m²a angenommen.<br />
Tab. 91: Lit+Tab.: erzielbare Wärmeleistung aus Erdreich nach Stiebel-Eltron 1991<br />
Annahme zum Errechnen von m² theoretische Erd-Kollektorfläche für Wärmepumpe: Wurzel <strong>der</strong><br />
Baufläche (x2 Geometriefaktor) mit 25 m Breite, weiter entfernte Kollektoren nicht üblich; daher<br />
niedriger als Kaltschmitt - 189.700 m² nach Berechnung Kaltschmitt & Neubarth, Erneuerbare<br />
<strong>Energie</strong>n in Österreich, 2000. Der Wärmepumpenmarkt in Österreich 2006, 2007 spricht von 68,8%<br />
Umweltwärme also 1:2,2 Wärmepumpenenergie-Input, meist Strom zu genutzte Umweltwärme - da<br />
in NÖ mit För<strong>der</strong>situation höhere JAZ vorhanden, wird mit 1:2,5 gerechnet.<br />
Tab. 92: <strong>Energie</strong>potential aus Wärmepumpen <strong>und</strong> dazu erfor<strong>der</strong>liche Strommenge – KEM ASTEG<br />
4,8 GWh Wärme aus Erdreich möglich, dafür jedoch 1,9 GWh Strom zusätzlich benötigt. Wegen<br />
des Strombedarfs Maßnahme eher zweit gereiht.<br />
<strong>Energie</strong>agentur <strong>der</strong> Regionen T 02842 / 9025 - 40871 87