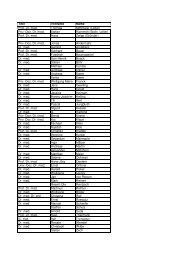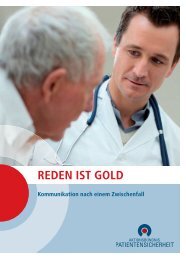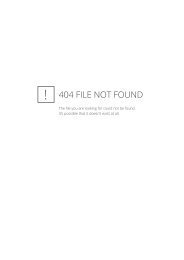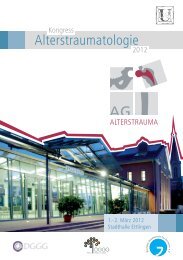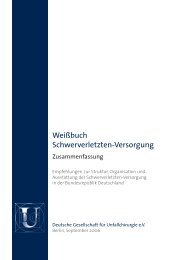Orthopädie und Unfallchirurgie - Deutsche Gesellschaft für ...
Orthopädie und Unfallchirurgie - Deutsche Gesellschaft für ...
Orthopädie und Unfallchirurgie - Deutsche Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aus unserem Fach<br />
heißt, sie berücksichtigen „Patienten,<br />
welche Verletzungen von mindestens<br />
zwei Körperregionen aufweisen, von<br />
denen mindestens eine lebensbedrohlich<br />
ist“. Ein Score oder gar messbare Parameter<br />
waren <strong>und</strong> sind in dieser Definition<br />
nicht enthalten oder vorgesehen.<br />
Die bisherigen Beschreibungen von Border,<br />
Tscherne <strong>und</strong> Trentz (Verletzungen<br />
von mindestens zwei Körperegionen,<br />
von denen mindestens eine lebensbedrohlich<br />
ist) waren sinnvoll <strong>und</strong> nutzbringend<br />
für schwerverletzte Patienten.<br />
Zur Klassifikation von Verletzungen ist<br />
eine messbarere Einteilung als die der<br />
oben genannten Definitionen sinnvoll.<br />
Trotz der bekannten Mängel des Injury<br />
Severity Score (ISS) scheint zur Zeit<br />
<strong>und</strong> weiterhin dieser der bedeutsamste<br />
<strong>und</strong> wichtigste Score zu sein, um einen<br />
Vergleich von Patienten mit schweren<br />
Verletzungen zu erbringen. Insofern<br />
erscheint es zur Erlangung einer neuen<br />
Definition des Schwerverletzten weiterhin<br />
sinnvoll, vorhandene <strong>und</strong> bewährte<br />
Strukturen zu nutzen <strong>und</strong> eventuell<br />
weiterzuentwickeln. In Europa existieren<br />
zur Zeit verschiedene Initiativen zur<br />
Neudefinition des Polytraumas, welche<br />
zum Teil politikgesteuert, zum Teil<br />
durch ärztliche Initiativen getriggert<br />
sind. Diese haben allesamt zum Ziel, im<br />
frühen klinischen Verlauf die Steuerung<br />
hinsichtlich Wahl des Krankenhauses,<br />
Therapie, Prognose zu bewirken.<br />
Terminologie: „Polytrauma“, „multiply<br />
injured“, „Schwerverletzter“, Schwerstverletzter“,<br />
„lebensbedrohlich Verletzter“<br />
Im Rahmen der Konsensuskonferenz<br />
wurde ebenfalls der ideale Terminus diskutiert.<br />
Die bisherige Verwendung der<br />
oben genannten Nomenklatur ist nicht<br />
exakt formuliert oder definiert, zumeist<br />
wird sie nach subjektiven Kriterien verwendet.<br />
Einheitliche Richtlinien existieren<br />
nicht. Auch in der S3-Leitlinie ist eine<br />
stringente Verwendung der verschiedenen<br />
Nomenklaturen nicht durch Literatur<br />
belegt. Dennoch herrscht Übereinstimmung<br />
dahingehend, dass eine Vereinheitlichung<br />
Sinn macht <strong>und</strong> idealerweise<br />
durch Fakten belegbar sein sollte.<br />
Der Terminus „Polytrauma“ wurde bis<br />
vor circa zehn Jahren im Wesentlichen<br />
nur in Europa verwendet. In der englischsprachigen<br />
Literatur wurde zumeist<br />
ausschließlich zwischen „isolated injuries“<br />
<strong>und</strong> „multiple injuries“ unterschieden<br />
– darüberhinaus gab es keine weitere<br />
Spezifikation. Ob dies an der Strukturierung<br />
der Traumazentren anhand der<br />
ISS-Grenzen lag, ist denkbar, aber nicht<br />
belegt. Im deutschsprachigen Raum sind<br />
bis heute nur die Abgrenzung zwischen<br />
„Polytrauma“ <strong>und</strong> „Barytrauma“ beschrieben<br />
– eine Abgrenzung hinsichtlich<br />
der Schwer- <strong>und</strong> Schwerstverletzten<br />
existiert nicht. Zwar lässt sich der Begriff<br />
„lebensgefährlich Verletzter“ hinsichtlich<br />
eines akuten Interventionsbedarfes<br />
Unfälle <strong>und</strong> Verunglückte im Straßenverkehr<br />
Gegenstand der Nachweisung Einheit 2008 2009 2010 2011<br />
1<br />
Alkohol <strong>und</strong> andere berauschende Mittel. Bis 2007 Sonstige Alkoholunfälle.<br />
Polizeilich erfasste Unfälle insgesamt Anzahl 2.293.663 2.313.453 2.411.271 2.361.457<br />
davon<br />
Unfälle mit Personenschaden Anzahl 320.614 310.806 288.297 306.266<br />
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden<br />
im engeren Sinne Anzahl 91.144 89.519 92.107 81.487<br />
unter dem Einfluss berauschender<br />
Mittel 1 Anzahl 18.205 17.169 16.034 16.261<br />
Übrige Sachschadensunfälle Anzahl 1.863.700 1.895.959 2.014.833 1.957.443<br />
Verunglückte insgesamt Anzahl 413.524 401.823 374.818 396.374<br />
davon<br />
Getötete Anzahl 4.477 4.152 3.648 4.009<br />
Schwerverletzte Anzahl 70.644 68.567 62.620 68.985<br />
Leichtverletzte<br />
Tab. Polizeilich erfasste Unfälle (Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2012)<br />
separieren, wird aber nur in Kursen zur<br />
Versorgung Schwerverletzter gelehrt.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> macht es Sinn,<br />
eine Bestandsaufnahme zu machen. Die<br />
Neudefinition des Schwerverletzten sollte<br />
deshalb in der Lage sein, nicht nur eine<br />
Abgrenzung zu isolierten Verletzungen<br />
zu sein, sondern auch eine grobe Unterteilung<br />
im Bezug auf den klinischen Verlauf<br />
ermöglichen. Im Rahmen der Konsensuskonferenz<br />
wurden weitere Vorteile<br />
diskutiert <strong>und</strong> zusammengefasst:<br />
Vorteile einer besseren Abgrenzung<br />
Schwer-<strong>und</strong> Schwerstverletzter<br />
■ Medizinische Gründe: Weiterbildung<br />
von Assistenten <strong>und</strong> Vereinfachung<br />
klinischer Erfahrung<br />
■ Politische Gründe: Ressourcenallokation<br />
von Krankenhäusern <strong>und</strong> Benchmarking<br />
■ Wissenschaftliche Gründe: Vereinheitlichung<br />
der Terminologie <strong>und</strong><br />
der Einschlusskriterien für klinische<br />
Studien<br />
Eine Möglichkeit, die Genauigkeit zu<br />
verbessern, besteht in der Einführung<br />
verschiedener Definitionen zu unterschiedlichen<br />
Zeitpunkten des klinischen<br />
Verlaufes. Diese könnten zum Beispiel<br />
am Unfallort, bei stationärer Aufnahme<br />
<strong>und</strong> im Intensivstationsverlauf erfolgen.<br />
Allerdings erfordert dies einen sehr hohen<br />
Dokumentationsaufwand. Die am<br />
Unfallort erhobenen Parameter sind allerdings<br />
nicht immer sehr akkurat im Bezug<br />
auf die Prognose, weshalb dieses als<br />
klinisch relevanter Definitionszeitpunkt<br />
nicht sinnvoll erscheint. Auch die Polizeidokumentation<br />
(stationäre Aufnahme ja/<br />
nein) erbringt keine Differenzierung, da<br />
viele Patienten trotz kurzer stationärer<br />
Überwachung wieder die Kliniken verlassen<br />
<strong>und</strong> somt die Schwerverletztendefinition<br />
verwässern würden.<br />
Auf der Basis dieser Überlegungen wurden<br />
Berechnungen anhand des <strong>Deutsche</strong>n<br />
Traumaregisters angestellt. Diese<br />
machen die Verwendung des ISS zur Bedingung,<br />
kombiniert mit weiteren Parametern,<br />
welche den klinischen Zustand<br />
des Patienten beschreiben. Hier sind<br />
Ähnlichkeiten zum revised trauma-Score<br />
vorhanden, jedoch ist eine klinische Verwendung<br />
unabdingbar, ähnlich wie bei<br />
der Beschreibung des „Borderline“-Patienten,<br />
welcher in Abhängigkeit von der<br />
Orthopädie <strong>und</strong> <strong>Unfallchirurgie</strong> Mitteilungen <strong>und</strong> Nachrichten | August 2012<br />
399