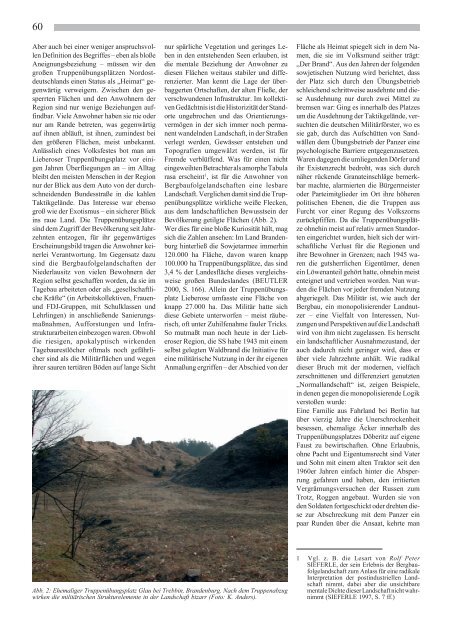Druck - Deutscher Rat für Landespflege
Druck - Deutscher Rat für Landespflege
Druck - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60<br />
Aber auch bei einer weniger anspruchsvollen<br />
Definition des Begriffes – eben als bloße<br />
Aneignungsbeziehung – müssen wir den<br />
großen Truppenübungsplätzen Nordostdeutschlands<br />
einen Status als „Heimat“ gegenwärtig<br />
verweigern. Zwischen den gesperrten<br />
Flächen und den Anwohnern der<br />
Region sind nur wenige Beziehungen auffindbar.<br />
Viele Anwohner haben sie nie oder<br />
nur am Rande betreten, was gegenwärtig<br />
auf ihnen abläuft, ist ihnen, zumindest bei<br />
den größeren Flächen, meist unbekannt.<br />
Anlässlich eines Volksfestes bot man am<br />
Lieberoser Truppenübungsplatz vor einigen<br />
Jahren Überfliegungen an – im Alltag<br />
bleibt den meisten Menschen in der Region<br />
nur der Blick aus dem Auto von der durchschneidenden<br />
Bundesstraße in die kahlen<br />
Taktikgelände. Das Interesse war ebenso<br />
groß wie der Exotismus – ein sicherer Blick<br />
ins raue Land. Die Truppenübungsplätze<br />
sind dem Zugriff der Bevölkerung seit Jahrzehnten<br />
entzogen, für ihr gegenwärtiges<br />
Erscheinungsbild tragen die Anwohner keinerlei<br />
Verantwortung. Im Gegensatz dazu<br />
sind die Bergbaufolgelandschaften der<br />
Niederlausitz von vielen Bewohnern der<br />
Region selbst geschaffen worden, da sie im<br />
Tagebau arbeiteten oder als „gesellschaftliche<br />
Kräfte“ (in Arbeitskollektiven, Frauenund<br />
FDJ-Gruppen, mit Schulklassen und<br />
Lehrlingen) in anschließende Sanierungsmaßnahmen,<br />
Aufforstungen und Infrastrukturarbeiten<br />
einbezogen waren. Obwohl<br />
die riesigen, apokalyptisch wirkenden<br />
Tagebaurestlöcher oftmals noch gefährlicher<br />
sind als die Militärflächen und wegen<br />
ihrer sauren tertiären Böden auf lange Sicht<br />
nur spärliche Vegetation und geringes Leben<br />
in den entstehenden Seen erlauben, ist<br />
die mentale Beziehung der Anwohner zu<br />
diesen Flächen weitaus stabiler und differenzierter.<br />
Man kennt die Lage der überbaggerten<br />
Ortschaften, der alten Fließe, der<br />
verschwundenen Infrastruktur. Im kollektiven<br />
Gedächtnis ist die Historizität der Standorte<br />
ungebrochen und das Orientierungsvermögen<br />
in der sich immer noch permanent<br />
wandelnden Landschaft, in der Straßen<br />
verlegt werden, Gewässer entstehen und<br />
Topografien umgewälzt werden, ist für<br />
Fremde verblüffend. Was für einen nicht<br />
eingeweihten Betrachter als amorphe Tabula<br />
rasa erscheint 1 , ist für die Anwohner von<br />
Bergbaufolgelandschaften eine lesbare<br />
Landschaft. Verglichen damit sind die Truppenübungsplätze<br />
wirkliche weiße Flecken,<br />
aus dem landschaftlichen Bewusstsein der<br />
Bevölkerung getilgte Flächen (Abb. 2).<br />
Wer dies für eine bloße Kuriosität hält, mag<br />
sich die Zahlen ansehen: Im Land Brandenburg<br />
hinterließ die Sowjetarmee immerhin<br />
120.000 ha Fläche, davon waren knapp<br />
100.000 ha Truppenübungsplätze, das sind<br />
3,4 % der Landesfläche dieses vergleichsweise<br />
großen Bundeslandes (BEUTLER<br />
2000, S. 166). Allein der Truppenübungsplatz<br />
Lieberose umfasste eine Fläche von<br />
knapp 27.000 ha. Das Militär hatte sich<br />
diese Gebiete unterworfen – meist räuberisch,<br />
oft unter Zuhilfenahme fauler Tricks.<br />
So mutmaßt man noch heute in der Lieberoser<br />
Region, die SS habe 1943 mit einem<br />
selbst gelegten Waldbrand die Initiative für<br />
eine militärische Nutzung in der ihr eigenen<br />
Anmaßung ergriffen – der Abschied von der<br />
Fläche als Heimat spiegelt sich in dem Namen,<br />
die sie im Volksmund seither trägt:<br />
„Der Brand“. Aus den Jahren der folgenden<br />
sowjetischen Nutzung wird berichtet, dass<br />
der Platz sich durch den Übungsbetrieb<br />
schleichend schrittweise ausdehnte und diese<br />
Ausdehnung nur durch zwei Mittel zu<br />
bremsen war: Ging es innerhalb des Platzes<br />
um die Ausdehnung der Taktikgelände, versuchten<br />
die deutschen Militärförster, wo es<br />
sie gab, durch das Aufschütten von Sandwällen<br />
dem Übungsbetrieb der Panzer eine<br />
psychologische Barriere entgegenzusetzen.<br />
Waren dagegen die umliegenden Dörfer und<br />
ihr Existenzrecht bedroht, was sich durch<br />
näher rückende Granateinschläge bemerkbar<br />
machte, alarmierten die Bürgermeister<br />
oder Parteimitglieder im Ort ihre höheren<br />
politischen Ebenen, die die Truppen aus<br />
Furcht vor einer Regung des Volkszorns<br />
zurückpfiffen. Da die Truppenübungsplätze<br />
ohnehin meist auf relativ armen Standorten<br />
eingerichtet wurden, hielt sich der wirtschaftliche<br />
Verlust für die Regionen und<br />
ihre Bewohner in Grenzen; nach 1945 waren<br />
die gutsherrlichen Eigentümer, denen<br />
ein Löwenanteil gehört hatte, ohnehin meist<br />
enteignet und vertrieben worden. Nun wurden<br />
die Flächen vor jeder fremden Nutzung<br />
abgeriegelt. Das Militär ist, wie auch der<br />
Bergbau, ein monopolisierender Landnutzer<br />
– eine Vielfalt von Interessen, Nutzungen<br />
und Perspektiven auf die Landschaft<br />
wird von ihm nicht zugelassen. Es herrscht<br />
ein landschaftlicher Ausnahmezustand, der<br />
auch dadurch nicht geringer wird, dass er<br />
über viele Jahrzehnte anhält. Wie radikal<br />
dieser Bruch mit der modernen, vielfach<br />
zerschnittenen und differenziert genutzten<br />
„Normallandschaft“ ist, zeigen Beispiele,<br />
in denen gegen die monopolisierende Logik<br />
verstoßen wurde:<br />
Eine Familie aus Fahrland bei Berlin hat<br />
über vierzig Jahre die Unerschrockenheit<br />
besessen, ehemalige Äcker innerhalb des<br />
Truppenübungsplatzes Döberitz auf eigene<br />
Faust zu bewirtschaften. Ohne Erlaubnis,<br />
ohne Pacht und Eigentumsrecht sind Vater<br />
und Sohn mit einem alten Traktor seit den<br />
1960er Jahren einfach hinter die Absperrung<br />
gefahren und haben, den irritierten<br />
Vergrämungsversuchen der Russen zum<br />
Trotz, Roggen angebaut. Wurden sie von<br />
den Soldaten fortgeschickt oder drehten diese<br />
zur Abschreckung mit dem Panzer ein<br />
paar Runden über die Ansaat, kehrte man<br />
Abb. 2: Ehemaliger Truppenübungsplatz Glau bei Trebbin, Brandenburg. Nach dem Truppenabzug<br />
wirken die militärischen Strukturelemente in der Landschaft bizarr (Foto: K. Anders).<br />
1 Vgl. z. B. die Lesart von Rolf Peter<br />
SIEFERLE, der sein Erlebnis der Bergbaufolgelandschaft<br />
zum Anlass für eine radikale<br />
Interpretation der postindustriellen Landschaft<br />
nimmt, dabei aber die unsichtbare<br />
mentale Dichte dieser Landschaft nicht wahrnimmt<br />
(SIEFERLE 1997, S. 7 ff.)