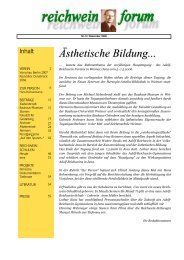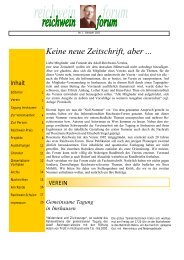Der Lehrer wird's schon richten,... - Adolf-Reichwein-Verein
Der Lehrer wird's schon richten,... - Adolf-Reichwein-Verein
Der Lehrer wird's schon richten,... - Adolf-Reichwein-Verein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eichwein forum Nr. 8 / Juli 2006<br />
von dieser Haltung nicht ausnehmen. Vollkommene, ursprüngliche,<br />
reine Dinge in �rechter�, �echter� Form sollen<br />
den Menschen umgeben, und an ihnen soll er lernen,<br />
bewusst, effizient und vernünftig mit seiner Welt<br />
umzugehen.<br />
Das Bauhaus<br />
Auch der Einfluss des Bauhauses auf Dexel ist deutlich.<br />
Während seine frühen Bilder � vorwiegend Landschaften<br />
und Stadtsituationen � oft Anklänge an uns bekannte<br />
Bilder und Sujets, etwa von Cezanne, Kirchner, oder den<br />
Kubisten zeigen, wird mit Gründung des Bauhauses in<br />
Weimar und seiner Bekanntschaft mit dem �de Stijl�-<br />
Begründer van Doesburg seine Malerei schnell konstruktivistisch.<br />
Seine Typographie folgt merklich der des Bauhausmeisters<br />
Herbert Bayer, der 1925 die Leitung der<br />
Abteilung �Druck und Reklame� am Bauhaus übernimmt.<br />
Nahezu zeitgleich beginnen Dexels Aktivitäten in den<br />
Bereichen Reklame und Typographie.<br />
Wir assoziieren das Bauhaus fälschlich immer zunächst<br />
mit Architektur. Das ist nicht richtig, denn das Bauhaus<br />
war viel mehr. Auch die von Dexel propagierte Forderung<br />
der Einheit der Künste, der Zusammenführung von<br />
Kunst und Handwerk, von Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen,<br />
die Idee, Kunst und Künstlerausbildung<br />
der Lebenswirklichkeit näher zu bringen, alles das<br />
ist mit dem Bauhaus verbunden. Nicht in jedem Falle<br />
aber ist es originär Bauhaus, sondern Weiterführung von<br />
Strömungen, die bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
beginnen und an denen noch heute berühmte Namen<br />
wie Schinkel, Semper oder Beuth festgemacht werden.<br />
So die Verbindung von Material, Zweck und Form.<br />
Schon bei Semper waren z.B. Material, Zweck und Form<br />
Leitprinzipien des künstlerischen Schaffens. Das wird<br />
von vielen Zeitgenossen aufgenommen, wie etwa Julius<br />
Lessing, Direktor des Berliner Kunstgewerbemuseums,<br />
der 1894 anmerkt, dass die Geräte aus der Zweckbestimmung,<br />
aus dem Material und aus der Technik ihre<br />
Form erhalten. Wir finden das dann später auch bei Dexel<br />
und <strong>Reichwein</strong> (z.B. �Kinder werken in Holz�) wieder.<br />
Und die Vorstellung von der Einheit der Kunst und Kultur<br />
kann man, wenn´s denn sein soll, sogar auf Nietzsche<br />
zurückführen: �Kultur ist vor allem Einheit des künstlerischen<br />
Stiles in allen Lebensäusserungen eines Volkes.<br />
Vieles Wissen und Gelernthaben ist aber weder ein<br />
nothwendiges Mittel der Kultur, noch ein Zeichen derselben<br />
und verträgt sich nöthigenfalls auf das beste mit<br />
dem Gegensatze der Kultur, der Barbarei, das heisst:<br />
der Stillosigkeit oder dem chaotischen Durcheinander<br />
aller Stile�. 101 Dieses chaotische Durcheinander aber<br />
101 Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemäße Betrachtungen.<br />
Erstes Stück: David Strauss der Bekenner und der<br />
Schriftsteller.<br />
41<br />
lässt sich nur verhindern, wenn alle Künste engstens zusammenwirken<br />
und an dem gemeinsamen Werk arbeiten.<br />
Gropius: �Mit der Wiederbelebung jener erprobten Arbeitsweise<br />
[die mittelalterliche Bauhütte], die sich der<br />
neuen Welt entsprechend anpassen wird, muss das<br />
Ausdrucksbild unserer modernen Lebensäußerungen an<br />
Einheitlichkeit gewinnen, um sich wieder in kommenden<br />
Tagen zu einem neuen Stile zu verdichten�. 102<br />
Das Bauhaus repräsentiert aber auch keinen �Stil�, wie<br />
wir vielfach meinen, es ist viel eher eine Lehre, eine<br />
Weltsicht. Walter Dexel selbst hat die Annahme, es gäbe<br />
so etwas wie einen Bauhausstil, als Klischee und Mythos<br />
bezeichnet 103 .<br />
Das Bauhaus war vielmehr in einer gesellschaftlichen,<br />
wirtschaftlichen und politischen Krisensituation, in einer<br />
Aufbruchsituation auch, der vom Künstlerischen ausgehende<br />
Entwurf einer sozialen Utopie. Dahinter stand<br />
diese Idee von einer besseren Welt und einer besseren<br />
Gesellschaft auf der Basis von Harmonie und einer neuen<br />
Brüderlichkeit unter den Menschen. Die Bauhauslehre<br />
war eine Erziehungsutopie, die an der Heranbildung<br />
eines neuen Menschen für eine neue Gesellschaft arbeitete.<br />
Insofern spricht man durchaus zu Recht auch von<br />
einer Bauhauspädagogik. Sie hatte den neuen Menschen<br />
zum Ziel, an dem auch <strong>Adolf</strong> <strong>Reichwein</strong> mit seinen<br />
Mitteln arbeitete. Schon 1921 unterstreicht Oskar<br />
Schlemmer, dass das Bauhaus nicht im Sinne der Baumeister<br />
und Architekten baue, sondern am Menschen<br />
104<br />
, oder, wie Moholy-Nagy 1929 sagt, �nicht das Objekt,<br />
der Mensch ist das Ziel�. 105<br />
Diese Utopie war jener �große Bau�, an dem laut Gründungsprogramm<br />
von 1919 gearbeitet werden sollte. Das<br />
war aber nicht vordergründig architektonisch gemeint,<br />
sondern reicht darüber hinaus: "Das Endziel aller bildnerischen<br />
Tätigkeit ist der Bau. Ihn zu schmücken war<br />
einst die Aufgabe der bildenden Künste, sie waren unablösliche<br />
Bestandteile der großen Baukunst. Heute<br />
stehen sie in selbstgenügsamer Eigenheit, aus der sie<br />
erst wieder erlöst werden können durch bewußtes Mitund<br />
Ineinanderwirken aller Werkleute untereinander. Architekten,<br />
Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige<br />
Gestalt des Baues in seiner Gesamtheit und in seinen<br />
Teilen wieder kennen und begreifen lernen, dann werden<br />
sich von selbst ihre Werke wieder mit architektonischem<br />
Geiste füllen, den sie in der Salonkunst verloren.<br />
102 Wingler, Hans M.: Das Bauhaus 1919-1933. Bramsche<br />
1968, S. 30<br />
103 Dexel, Walter: <strong>Der</strong> Bauhausstil � ein Mythos. Hrsg. v. Walter<br />
Vitt, Szarnberg 1976, S. 19<br />
104 Schlemmer, Oskar: Briefe und Tagebücher. Hrsg. V. Tut<br />
Schlemmer. Stuttgart 1977, S. 48<br />
105 Moholy-Nagy, Lazlo: Vom Material zur Architektur<br />
(=Bauhausbücher. 14.) München 1929, S. 14