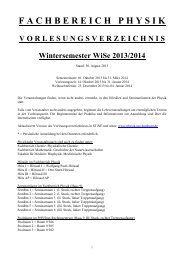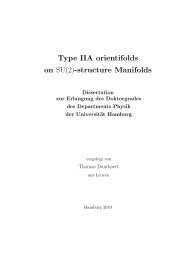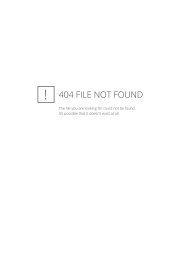Volltext - Universität Hamburg
Volltext - Universität Hamburg
Volltext - Universität Hamburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8. Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Wärmelastgrenzen der Bragg-Reflexion<br />
t PZ t Rep<br />
Laserpulse<br />
t Sep<br />
∆t<br />
Synchrotronstrahlungspulse<br />
Abbildung 8.9.: Schematische Darstellung der Laserpulse und Röntgen-Lichtpulse.<br />
Zeit<br />
berufen sich die hier gemachten Angaben auf Herstellerinformationen.<br />
Pulserzeuger<br />
Ein Akusto-Optischer Modulator (AOM) (GPM-400-100, Brimrose Corp.) generiert aus dem<br />
Dauerstrichlaser einen Pulszug von 600 µs Länge (siehe Abb. 8.9). Die zeitliche Struktur des<br />
Pulszugs und der Pulse innerhalb des Pulszugs lässt sich mit einem Pulsgenerator (9530, Quantum<br />
Electronics) bestimmen. Es werden 10 ns lange Pulse im Abstand von etwa t Sep ≈ 200 ns<br />
erzeugt. Die Pulswiederholrate ist dabei durch den Elektronenspeicherring gegeben. Die Maschinenreferenzfrequenz<br />
des Elektronenspeicherrings ist der Trigger für den Pulsgenerator, um<br />
die Pulse des Lasers mit denen des Elektronenspeicherrings zu synchronisieren. Die minimale<br />
Pulsdauer ist aufgrund der Anstiegs- und Abfallzeiten des AOMs etwa 10 ns. AOMs mit schnelleren<br />
Anstiegs- und Abfallzeiten könnten genutzt werden, um kürzere Pulse zu erzeugen, was<br />
jedoch die maximale Pulsenergie reduziert. Dafür wäre eine gepulste Quelle sinnvoller, wobei<br />
der AOM als Pulspicker dienen könnte. In dem hier genutzten Laser ist es durch den Pulsgenerator,<br />
der mit der Maschinenreferenzfrequenz synchronisiert werden kann, möglich, die Länge des<br />
Zeitfensters zu bestimmen in denen die Pulse mit dem vorher definierten Zeitabstand erzeugt<br />
werden sollen. Ein räumlicher Filter erhöht den Kontrast zwischen den An- und Auszeiten des<br />
AOMs um den Faktor 20 (Thurow et al., 2009).<br />
Verstärker<br />
Die hier verwandte Technik beruht auf Vorarbeiten von Beaud et al. (1995). Der Verstärker<br />
besteht aus vier Cr:LiSAF Kristallen (2 × (7 mm × 100 mm) und 2 × (10 mm × 100 mm), die in<br />
einem kleinen Winkel durchlaufen werden, um den einlaufenden und den auslaufenden Strahl<br />
zu separieren. Die Polarisation des Lichts muss beim Durchgang durch den Kristall gleich bleiben,<br />
da eine Polarisationsebene eine höhere Verstärkung aufweist (Rapoport, 1992; Beaud<br />
et al., 1995). Mit einer Wellenplatte vor den Verstärkerkristallen lässt sich die Polarisation einstellen,<br />
sodass die Polarisationsebene mit der höheren Verstärkung genutzt werden kann. Die<br />
Cr:LiSAF Kristalle werden mit jeweils zwei Blitzlampen (E2095, EM2095, Fenix) gepumpt, sodass<br />
innerhalb eines Zeitfensters von 600 µs Pulse aus der Quelle verstärkt werden. Der Strom<br />
der Blitzlampen wird mit einem Computer gesteuert und mit dem Pulserzeuger und der Quelle<br />
synchronisiert, damit die Pulsenergie über den Pulszug reguliert werden kann. Aufgrund der<br />
thermischen Eigenschaften des Kristalls (Pilla et al., 2004), ist die Pulszugwiederholrate des<br />
Verstärkers mit der vorgesehenen Kühlung von t Rep = 3.33 s begrenzt. Die Verstärkung der<br />
106