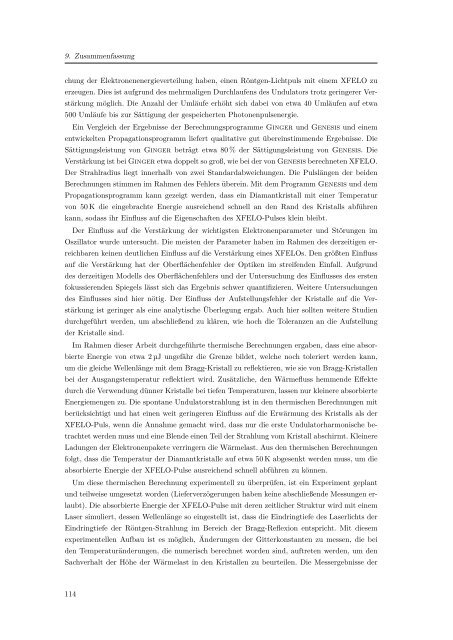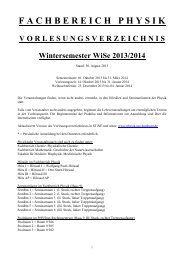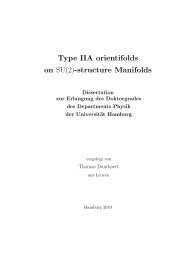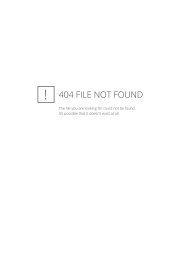Volltext - Universität Hamburg
Volltext - Universität Hamburg
Volltext - Universität Hamburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
9. Zusammenfassung<br />
chung der Elektronenenergieverteilung haben, einen Röntgen-Lichtpuls mit einem XFELO zu<br />
erzeugen. Dies ist aufgrund des mehrmaligen Durchlaufens des Undulators trotz geringerer Verstärkung<br />
möglich. Die Anzahl der Umläufe erhöht sich dabei von etwa 40 Umläufen auf etwa<br />
500 Umläufe bis zur Sättigung der gespeicherten Photonenpulsenergie.<br />
Ein Vergleich der Ergebnisse der Berechnungsprogramme Ginger und Genesis und einem<br />
entwickelten Propagationsprogramm liefert qualitative gut übereinstimmende Ergebnisse. Die<br />
Sättigungsleistung von Ginger beträgt etwa 80 % der Sättigungsleistung von Genesis. Die<br />
Verstärkung ist bei Ginger etwa doppelt so groß, wie bei der von Genesis berechneten XFELO.<br />
Der Strahlradius liegt innerhalb von zwei Standardabweichungen. Die Pulslängen der beiden<br />
Berechnungen stimmen im Rahmen des Fehlers überein. Mit dem Programm Genesis und dem<br />
Propagationsprogramm kann gezeigt werden, dass ein Diamantkristall mit einer Temperatur<br />
von 50 K die eingebrachte Energie ausreichend schnell an den Rand des Kristalls abführen<br />
kann, sodass ihr Einfluss auf die Eigenschaften des XFELO-Pulses klein bleibt.<br />
Der Einfluss auf die Verstärkung der wichtigsten Elektronenparameter und Störungen im<br />
Oszillator wurde untersucht. Die meisten der Parameter haben im Rahmen des derzeitigen erreichbaren<br />
keinen deutlichen Einfluss auf die Verstärkung eines XFELOs. Den größten Einfluss<br />
auf die Verstärkung hat der Oberflächenfehler der Optiken im streifenden Einfall. Aufgrund<br />
des derzeitigen Modells des Oberflächenfehlers und der Untersuchung des Einflusses des ersten<br />
fokussierenden Spiegels lässt sich das Ergebnis schwer quantifizieren. Weitere Untersuchungen<br />
des Einflusses sind hier nötig. Der Einfluss der Aufstellungsfehler der Kristalle auf die Verstärkung<br />
ist geringer als eine analytische Überlegung ergab. Auch hier sollten weitere Studien<br />
durchgeführt werden, um abschließend zu klären, wie hoch die Toleranzen an die Aufstellung<br />
der Kristalle sind.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte thermische Berechnungen ergaben, dass eine absorbierte<br />
Energie von etwa 2 µJ ungefähr die Grenze bildet, welche noch toleriert werden kann,<br />
um die gleiche Wellenlänge mit dem Bragg-Kristall zu reflektieren, wie sie von Bragg-Kristallen<br />
bei der Ausgangstemperatur reflektiert wird. Zusätzliche, den Wärmefluss hemmende Effekte<br />
durch die Verwendung dünner Kristalle bei tiefen Temperaturen, lassen nur kleinere absorbierte<br />
Energiemengen zu. Die spontane Undulatorstrahlung ist in den thermischen Berechnungen mit<br />
berücksichtigt und hat einen weit geringeren Einfluss auf die Erwärmung des Kristalls als der<br />
XFELO-Puls, wenn die Annahme gemacht wird, dass nur die erste Undulatorharmonische betrachtet<br />
werden muss und eine Blende einen Teil der Strahlung vom Kristall abschirmt. Kleinere<br />
Ladungen der Elektronenpakete verringern die Wärmelast. Aus den thermischen Berechnungen<br />
folgt, dass die Temperatur der Diamantkristalle auf etwa 50 K abgesenkt werden muss, um die<br />
absorbierte Energie der XFELO-Pulse ausreichend schnell abführen zu können.<br />
Um diese thermischen Berechnung experimentell zu überprüfen, ist ein Experiment geplant<br />
und teilweise umgesetzt worden (Lieferverzögerungen haben keine abschließende Messungen erlaubt).<br />
Die absorbierte Energie der XFELO-Pulse mit deren zeitlicher Struktur wird mit einem<br />
Laser simuliert, dessen Wellenlänge so eingestellt ist, dass die Eindringtiefe des Laserlichts der<br />
Eindringtiefe der Röntgen-Strahlung im Bereich der Bragg-Reflexion entspricht. Mit diesem<br />
experimentellen Aufbau ist es möglich, Änderungen der Gitterkonstanten zu messen, die bei<br />
den Temperaturänderungen, die numerisch berechnet worden sind, auftreten werden, um den<br />
Sachverhalt der Höhe der Wärmelast in den Kristallen zu beurteilen. Die Messergebnisse der<br />
114