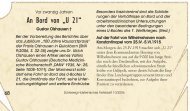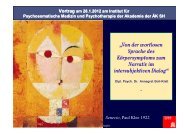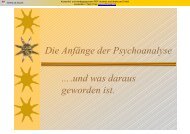Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 4/2010 - Ärztekammer ...
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 4/2010 - Ärztekammer ...
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 4/2010 - Ärztekammer ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Medizin und Wissenschaft<br />
John-Rittmeister-Institut für Psychoanalyse<br />
Von der frühen Entwicklung zur<br />
künstlerischen Kreativität<br />
„Psychoanalyse und Kreativität - vom schöpferischen Potenzial der frühen<br />
Beziehungen“ lautete das Thema in der Vortragsreihe des Instituts zum Jahresbeginn.<br />
Die Referentin Dr. Christel Böhme-Bloem, deren Forschungsfeld<br />
die Symbolbildung ist, stellte zunächst<br />
den kreativen Prozess in der Entwicklung eines jeden<br />
Menschen dar. Dabei griff sie auf Donald Winnicott,<br />
Wilfred Bion, die Säuglings- und Mentalisierungsforscher<br />
und auf einige neurobiologische Erkenntnisse<br />
zurück. Danach wandte sie sich den Bedingungen für<br />
den schöpferischen Akt in Kunst und Therapie zu und<br />
versuchte zum Schluss, über die Interpretation eines<br />
kleinen romantischen Gedichts dem „Ergriffensein“<br />
im Rezeptionsprozess auf die Spur zu kommen.<br />
Im Wort Kreativität steckt das Verb „creare“ – „schaffen,<br />
etwas aktiv gestalten“ -, was der abendländischen<br />
Haltung zur Welt entspricht, während das verwandte<br />
Verb „crescere“ - „wachsen lassen“ - eher die meditative<br />
morgenländische Philosophie widerspiegelt. Der<br />
Schöpfungsmythos der Bibel zeigt die Menschen als<br />
Geschöpfe Gottes im Paradies, vergleichbar dem intrauterinen<br />
Dasein. Durch das Essen vom verbotenen<br />
Baum der Erkenntnis wird sich der Mensch seiner Möglichkeiten<br />
und Grenzen, seiner Sterblichkeit bewusst<br />
und versucht, schöpferisch etwas gegen die Vergänglichkeit<br />
zu setzen und dadurch Begrenztheit in Ewigkeit,<br />
Ohnmacht in Gestaltungsmacht zu verwandeln.<br />
Sigmund Freud, der kreative „Schöpfer“ der Psychoanalyse,<br />
zeigte sich dem Phänomen des Schöpferischen<br />
gegenüber eher skeptisch. Gelänge es ihm<br />
nicht, Kunstwerke, die eine starke Anziehung auf ihn<br />
ausübten, auf seine Weise zu erfassen, so sei er fast<br />
genussunfähig. Seine rationalistische, analytische<br />
Anlage sträube sich in ihm dagegen, dass er ergriffen<br />
sein sollte, ohne zu begreifen, warum.<br />
Nach den frühen Freudschülern Otto Rank und Sandor<br />
Ferenczi zeigten besonders Michael Balint, Wilfred<br />
Bion und Donald Winnicott, dass die seelische<br />
Entwicklung untrennbar mit Kreativität verbunden<br />
ist. Winnicott beschreibt in seiner Arbeit „Vom Spiel<br />
zur Kreativität“, wie in der Entwicklung des Mutter-<br />
Kind-Paares zum psychischen Innenraum und zum<br />
Außenraum der realen Welt ein dritter Bereich, der<br />
56 <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holsteinisches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong><br />
sogenannte Intermediär- oder Übergangsraum hinzukommt,<br />
eine Sphäre, „in der das Individuum ausruhen<br />
darf von der lebenslänglichen Aufgabe, innere<br />
und äußere Realität getrennt zu halten.“ Dieser intermediäre<br />
Erfahrungsbereich begründe den größeren<br />
Teil der kindlichen Erfahrungen und bleibe das ganze<br />
Leben für außergewöhnliche Erfahrungen im Bereich<br />
der Kunst, der Religion, der Imagination und der<br />
schöpferischen wissenschaftlichen Arbeit erhalten.<br />
Übergangsphänomene und Übergangsobjekte wie<br />
etwa das Nuckeln, der Teddy oder das Schmusetuch<br />
sind vom Kind (kreativ) „gefundene“ Betätigungen<br />
oder Gegenstände, die sowohl die Anwesenheit<br />
als auch die Abwesenheit der Mutter symbolisieren<br />
und in Trennungssituationen oder beim Einschlafen<br />
unersetzliche Tröster werden.<br />
Der Tastsinn, anfangs der zentrale Sinn, vermittelt<br />
dem Säugling über die Wahrnehmung der Art, wie<br />
er gehalten, berührt und getragen wird, die sog. Vitalitätsaffekte.<br />
Säuglinge verfügen außerdem über<br />
eine angeborene Fähigkeit, Wahrnehmungen unterschiedlicher<br />
Sinnesorgane miteinander zu verbinden,<br />
die Fähigkeit zur transmodalen Wahrnehmung.<br />
Mit der Entdeckung der Spiegelneurone wurde das<br />
neurobiologische Substrat hierfür gefunden. Diese<br />
Spiegelneurone sorgen auch für ein implizites Wissen<br />
über den anderen, oder, wie Joachim Bauer es<br />
mit dem Titel seines Buches beschreibt: „Warum ich<br />
fühle, was du fühlst“.<br />
Über die eingefühlte Affektabstimmung übersetzt die<br />
Mutter die vom Säugling aufgenommenen „rohen“<br />
Affekte, zum Beispiel beim angestrengd-lustvollen<br />
Heben eines Bauklotzes, verdichtet und transmodal<br />
verschoben beispielsweise in Laute wie hier „Uuuuh!“<br />
oder in Begriffe und „füttert“ sie dadurch „verdaut“<br />
zurück. Verdichtung und Verschiebung sind<br />
die für das Unbewusste charakteristischen Prozesse<br />
und werden – symboltheoretisch gesprochen – so zu<br />
Prozessoren der semiotischen Progression, d. h., sie<br />
befördern letztlich die Übersetzung in Bewusstsein,