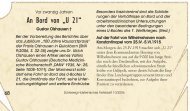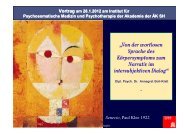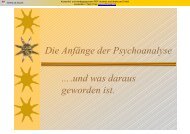Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 4/2010 - Ärztekammer ...
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 4/2010 - Ärztekammer ...
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 4/2010 - Ärztekammer ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4. Die Diagnose ist eine Ausschlussdiagnose.<br />
Praktisch konfrontiert sind damit in erster Linie Allgemeinmediziner,<br />
Internisten, Kardiologen, Anästhesisten/Intensivmediziner,<br />
Orthopäden, Neurologen,<br />
Pulmologen und der Bereich der physikalischen Medizin.<br />
Das PPS ist zugleich ein therapeutisches Problem,<br />
denn es gibt keine hinreichend befriedigende<br />
physiotherapeutische und medikamentöse Einflussmöglichkeit.<br />
Kausal handelt es sich um einen neurogenen<br />
Strukturdefekt. Dieser ist als solcher nicht<br />
heilbar, sondern nur eingeschränkt symptomatisch<br />
behandelbar. Die wesentliche Therapie besteht in einer<br />
dosierten Entlastung des neuromuskulären Systems<br />
einschließlich der respiratorischen Komponente.<br />
Das gilt gleichfalls für die kontrollierte Physiotherapie<br />
unter Beachtung ihrer speziellen Risiken bezüglich<br />
des PPS. Nicht vergessen werden darf die<br />
Überlastungsprävention auf psychischem Gebiet.<br />
Bei seiner Gratwanderung zwischen Minder- und<br />
Überbeanspruchung befindet sich der Patient in einem<br />
Circulus vitiosus mit zunehmender Behinderung.<br />
Damit erfüllt das PPS alle Bedingungen einer<br />
chronischen Erkrankung. Mobilität, funktionelle Unabhängigkeit<br />
und Entlastung sind nicht zuletzt auch<br />
durch technische Hilfsmittel vordringlich prophylaktisch<br />
zu befördern oder zu erhalten. Die Progredienz<br />
liegt bei ungefähr 1 Prozent jährlich und kann nach<br />
neueren Erkenntnissen bei vermuteter Altersabhängigkeit<br />
unter relativ extremer Belastung bis zu 17<br />
Prozent (Zitat FRANZ)) betragen, wobei die Altersabhängigkeit<br />
eigentlich als Ausdruck von Belastungsdauer,<br />
Belastungsgröße und Vorschadensgröße zu<br />
werten ist.<br />
Beim Einsatz von Medikamenten wurde bisher kein<br />
signifikant positiver Effekt auf das PPS nachgewiesen.<br />
Dagegen können PPS-Patienten durch eine unkritische<br />
Arzneiverordnung gefährdet werden. Das<br />
kann unter anderem bei Betablockern, Cholesterinsenkern,<br />
Myorelaxantien, Narkotika/Anästhetika,<br />
Opiaten und Psychopharmaka der Fall sein. Narkosen<br />
und Operationen stellen für diese Patienten ein<br />
besonderes Risiko dar. Besonders risikobehaftet ist<br />
die Atmung.<br />
Die oben genannten Probleme allein schränken häufig<br />
ihres Folgeaufwandes wegen den notwendigen<br />
Behandlungsumfang ein. Erschwerend kommt hinzu,<br />
dass bis heute ein mangelhafter spezifischer<br />
Kenntnisstand bei der überwiegenden Zahl der Ärzte<br />
und Patienten sowie leider auch eine nicht selten<br />
anzutreffende Ignoranz bei der medizinischen,<br />
Medizin und Wissenschaft<br />
einschließlich der sozialmedizinischen, der sozialen<br />
und sozialpolitischen Betreuung eine adäquate<br />
Versorgung der Betroffenen verhindert, ja darüber<br />
hinaus sehr häufig zu Fehldiagnosen, Fehlbehandlungen<br />
und Fehlentscheidungen mit teilweise fatalen<br />
Folgen für die Lebensqualität der PPS-Patienten<br />
führt. Die Probleme des PPS liegen grundsätzlich in<br />
der Sache, werden jedoch leider viel zu häufig zum<br />
Nachteil bzw. Schaden für den Patienten durch interpersonelle<br />
Probleme aus dem Arzt-Patient-Verhältnis<br />
überdeckt.<br />
Das Post-Polio-Syndrom lehrt uns, dass Poliomyelitisinfektion<br />
und Poliomyelitiserkrankung mehr Schäden<br />
setzen, als sich aus ihrem klinischen Erscheinungsbild<br />
und dem der Primärfolgen ableiten lässt.<br />
Es ist nicht heilbar, chronisch progredient, sein Verlauf<br />
ist weitgehend schicksalhaft und individuell sehr<br />
unterschiedlich ausgeprägt.<br />
Zur Vertiefung dieser abrisshaften Darstellung muss<br />
auf die zahlreichen einschlägigen Literaturstellen<br />
verwiesen werden.<br />
Literatur beim Verfasser oder im Internet unter<br />
www.aeksh.de<br />
Dr. Peter Brauer, Mitglied im Ärztlichen Beirat der Polio-Selbsthilfe<br />
e. V., Internet www.polio-selbsthilfe.net<br />
Ausgabe 4 | April <strong>2010</strong> 61