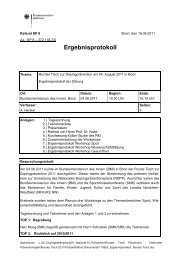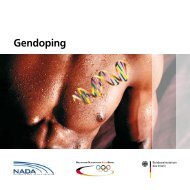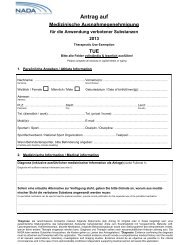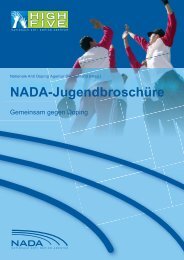NADA-Trainerhandbuch
NADA-Trainerhandbuch
NADA-Trainerhandbuch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1896 Arthur Linton<br />
Block B<br />
Folgen von Doping<br />
Am 23. Juli starb der Profi-Radsportler bei der Fernfahrt Bordeaux–Paris. Über die Ursache<br />
seines Todes kursieren verschiedene Darstellungen. Die einen geben an, Linton sei während des<br />
Rennens tot vom Rad gefallen; er habe sich unter Einfluss von Aufputschmitteln zu sehr verausgabt.<br />
Anderen Quellen zufolge starb Linton erst nach dem Rennen an einer Typhus-Infektion, weil<br />
Aufputschmittel seine Abwehrkräfte geschwächt hatten.<br />
Der Fall wurde nie eindeutig geklärt – anders als zwei berühmte Todesfälle in den 1960er Jahren:<br />
1960 Knut Enemark Jensen<br />
Der Radprofi aus Dänemark starb bei den Olympischen Sommerspielen in Rom im Mannschaftsradrennen<br />
über 100 km. Unmittelbare Todesursache war ein Hitzschlag. Später stellte sich jedoch<br />
heraus, dass die gesamte dänische Mannschaft mit Amphetaminen gedopt war.<br />
1967 Tom Simpson<br />
Der englische Fahrer starb sieben Jahre später, bei der Tour de France während der Etappe am<br />
Mont Ventoux. Untersuchungen nach seinem Tod ergaben, dass er eine Überdosis Amphetamin<br />
genommen hatte. Simpsons Tod sorgte dafür, dass Doping erstmals in der breiten Öffentlichkeit<br />
diskutiert wurde, und führte letztlich zum offiziellen Verbot von Doping. Bei den Olympischen<br />
Spielen 1968 in Mexiko City wurden die ersten Dopingkontrollen durchgeführt.<br />
Schon bald sollte sich zeigen, dass Doping nicht allein ein Problem des Radsports war – und<br />
Amphetamin nicht die einzige Dopingsubstanz.<br />
1968 Josef Elze<br />
Der Boxchampion starb nach einem Boxkampf an den Folgen einer Kopfverletzung. In seinem<br />
Blut wurden Aufputschmittel nachgewiesen. Es wird angenommen, dass diese sein Schmerzempfinden<br />
soweit herabgesetzt hatten, dass er die Verletzung nicht bemerkte.<br />
1987 Birgit Dressel<br />
Die Leichtathletin starb im Alter von nur 26 Jahren an mehrfachem Organversagen, ausgelöst<br />
wahrscheinliche durch einen allergischen Schock. Kurz vor Ihrem Tod hatte sie rund 120 verschiedene<br />
Substanzen und Medikamenten, unter anderem Anabolika, konsumiert.<br />
1987 Andreas Münzer<br />
Den Top-Bodybuilder ereilte im Alter von 31 Jahren das gleiche Schicksal wie Birgit Dressel: Tod<br />
durch multiples Organversagen nach jahrelangem massiven Anabolika-Missbrauch.<br />
1993 Uwe Beyer<br />
Der Hammerwerfer erlag im Frühjahr einem Herzinfarkt. Dass er Anabolika konsumierte, hatte er<br />
schon Jahre zuvor freimütig zugegeben.<br />
1998 Ralf Reichenbach<br />
Der Kugelstoßer starb im Alter von 47 Jahren an Herzversagen. Er hatte zuvor zugegeben, jahrelang<br />
mit Anabolika gedopt zu haben.<br />
1998 bis heute<br />
Eine ganze Reihe von Todesfällen gab es im Fußball vom Ende der 1990er Jahre bis in die<br />
Gegenwart: Im Jahr 1998 starben die Fußballer Axel Jüptner, Markus Paßlack und Emanuel<br />
Nwangegbo an Herzversagen, ebenso im Juni 2003 Kameruns Nationalspieler Vivien Foé,<br />
im Januar 2004 der Ungar Miklos Feher und im August 2007 der Spanier Antonio Puerta.<br />
Todesfälle durch Doping im 20. Jahrhundert<br />
<strong>NADA</strong>-<strong>Trainerhandbuch</strong> 2. Auflage – Juni 2012<br />
B25