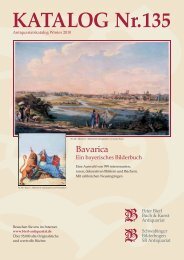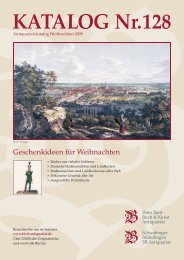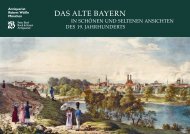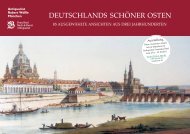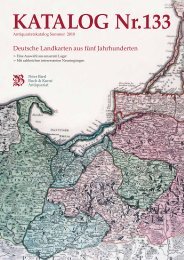850 Jahre München · Gemeinschaftskatalog der Antiquariate Robert ...
850 Jahre München · Gemeinschaftskatalog der Antiquariate Robert ...
850 Jahre München · Gemeinschaftskatalog der Antiquariate Robert ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
werk No. 10, mehrere Kanonen auf Lafetten, von Pferden gezogen<br />
vor einem großen Zeltlager. Im Vor<strong>der</strong>grund ein typisch<br />
Kobell’sches Kin<strong>der</strong>paar und ein Hund, in <strong>der</strong> Ferne Schloß Nymphenburg.<br />
Altkol. Umrißradierung von Adam Bartsch nach Wilhelm<br />
von Kobell, 1804, 37 x 52 cm. 4.250,—<br />
Vgl. Wichmann 705. - Nach dem Aquarell „Infanterie Bavaro Palatine / deßine<br />
d’apres le vrai par Guil. Kobell 1803“. Die Darstellung im Vor<strong>der</strong>grund gegenüber<br />
dem Aquarell nur minimal verän<strong>der</strong>t, das Zeltlager im Hintergrund und Schloß Nymphenburg<br />
jedoch neu hinzu gefügt. - Die breiten Rän<strong>der</strong> leicht gebräunt, minimal<br />
stockfleckig, sonst tadellos und farbfrisch erhalten. In zeitgenössische Nußholzleiste<br />
gerahmt. - Schönes und sehr seltenes Kapitalblatt! Siehe die Farbabbildung!<br />
362 - „Nymphfenburg bey <strong>München</strong>“. Vor dem Schloß mit seinen<br />
Nebengebäuden ein Weg mit bäuerlicher Staffage, links eine<br />
Schafherde. Radierung von Wilhelm von Kobell, bez. wie oben<br />
und sign. „Wilhelm Kobell a(qua) f(orti)“, 1818, 11 x 15,5 cm (Einfassungslinie).<br />
1.200,—<br />
Goedl-Roth 38; Slg. Maillinger Bd. IV, Nr. 419; Slg. Proebst 218. - Aus <strong>der</strong> Serie<br />
„Sieben Ansichten aus <strong>der</strong> Umgebung <strong>München</strong>s“. Aetzdruck vor den<br />
schraffierten Luftpartien und den fünf Wolken, Einfassungslinie oben noch<br />
nicht geschlossen. - Insgesamt etwas stockfleckig.<br />
363 - Schloss Nymphenburg. Kolorierte Lithographie von<br />
Joseph Carl Ettinger. <strong>München</strong>, gedruckt von Joseph Selb, um<br />
1823. 20,4 x 30 cm. 720,—<br />
IV. STADTTEILE UND VORORTE<br />
352 - Radierung von Christian Morgenstern 362 – Nymphenburg – Ätzdruck von Wilhelm von Kobell<br />
Nymphenburg – Nr. 360<br />
Die heutige Schlossanlage von Nymphenburg<br />
(Nr. 360 ff) lässt nur in Ansätzen erkennen, wie<br />
dieses „Maison de plaisance“, das „Lustschloß“,<br />
ursprünglich aussah. Den Namen Nymphenburg<br />
gab ihm die Kurfürstin Henriette Adelaide. Diese<br />
kapriziöse Prinzessin aus dem Hause Savoyen,<br />
eine Enkelin König Heinrichs IV. von Frankreich<br />
und <strong>der</strong> Maria Medici, brachte italienischen<br />
Geschmack und italienische Kultur mit nach<br />
Bayern. Sie nannte ihren neuen Sommeraufenthalt<br />
„Borgo delle Ninfe“, Nymphenburg.<br />
Das Schlösschen war ein Wochenbettgeschenk des<br />
Kurfürsten Ferdinand Maria an seine Gattin<br />
anlässlich <strong>der</strong> Geburt des heißersehnten Thronfolgers<br />
Max Emanuel. Als aus dem kleinen Kurprinzen<br />
<strong>der</strong> Kurfürst Maximilian II. Emanuel geworden<br />
war, erweiterte dieser Schlösschen und Gärtchen<br />
seiner Mutter zum Schloß mit großer Parkanlage.<br />
Sein Sohn, Kaiser Karl VII. Albrecht, ließ für<br />
seine von <strong>der</strong> Vogeljagd begeisterte Gemahlin<br />
Maria Amalia ein Rokokojuwel errichten: die nach<br />
<strong>der</strong> Kaiserin benannte Amalienburg. Die prächtige<br />
Innenausstattung ist ganz in den Jagdfarben Karl<br />
Albrechts gehalten: blau, gelb und silber.<br />
Maillinger I, 1817; Slg. Proebst 729; Thieme-Becker XI, 64. - Ansicht des<br />
Schlosses von Osten mit dem Schlossrondell. Der Landschaftsmaler, Lithograph<br />
und Dichter Joseph Carl Ettinger (1805 <strong>München</strong> 1860) widmete sich <strong>der</strong><br />
Malerei an <strong>der</strong> Münchner Akademie unter Wilhelm von Kobell und Max Joseph<br />
Wagenbauer. Aus <strong>der</strong> Folge „Ansichten <strong>der</strong> vorzüglichsten Gegenden des baierischen<br />
Hochlandes“. - Bis zum Rand beschnitten und aufgesetzt.<br />
364 - „Nymphenburg.“ Altkolorierte Aquatinta-Radierung von<br />
Jacob Gaisser, um 1826. 7,7 x 11,5 cm. 250,—<br />
Reizende kleine Ansicht in hübschem Altkolorit. Der Blick geht über den Kanal<br />
auf die Stadtseite des Schlosses. Im Vor<strong>der</strong>grund zwei Schwäne.<br />
365 - „Hartmannshofen bei Nymphenburg“. Blick auf ein<br />
Anwesen mit Bauern- bzw. Jägerhaus, Ställen und Zuhäusl, links<br />
ein Bildstöckl, mittig sichtbar die Frauentürme. Aquarell über<br />
Tuschzeichnung, verso bez. wie oben, um 1880, 19,5 x 25,5 cm.<br />
750,—<br />
Minutiös durchgeführte Arbeit eines begabten Malerdilettanten (Alte Fasanerie?).<br />
- Kleine Randläsuren, ein paar dünne Stellen alt hinterlegt, im Himmel ein<br />
alt restaurierter Papierdurchbruch. Siehe die Farbabbildung!<br />
366 - „Nymphenburg.“ Aquarellierte Bleistiftzeichnung von<br />
Philipp Röth, um 1900. Unten links im Bild bezeichnet und signiert<br />
„Nymphenburg.“ Ph. Röth“. 9,1 x 12,9 cm. 250,—<br />
Skizzenblatt des Malers Philipp Röth (Darmstadt 1841 - 1921 <strong>München</strong>).<br />
367 - Blick den Kanal entlang über Brücke hinweg zum<br />
Schloß, links große Eichen. Radierung von Peter Halm, um 1900,<br />
23 x 32 cm. 220,—<br />
368 - „Schloß Nymphenburg bei <strong>München</strong>.“ Farbige Radierung<br />
von Luigi Kasimir. <strong>München</strong>, Hanfstaengl, 1911. In <strong>der</strong><br />
Platte bezeichnet, signiert und datiert. 28 x 38 cm. 300,—<br />
Ansicht des Schlosses von <strong>der</strong> Parkseite im Winter. Luigi Kasimir (1881 - 1962)<br />
war einer <strong>der</strong> profiliertesten und produktivsten Graphiker Österreichs, und gilt<br />
heute noch als <strong>der</strong> bedeutendste Schöpfer von Stadtveduten des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts.<br />
- Im Rand etwas fl.<br />
369 - „Hirsch Garten“ mit zahlreichen Hirschen, links ein Futterstadel,<br />
„rechts vorn die Schiesshütte mit Balcon vom dem aus<br />
bei Treibjagden herabgeschossen wurde“ (Maillinger). Radierung<br />
von J.Gg. Wintter, 1784, 25 x 35 cm. 450,—<br />
Maillinger I, 1267; Slg. Proebst, 1221; Andresen, Hb. II, 2b. - Der Hirschgarten<br />
wurde von dem kurpfalzbayerischen Obrist-Jägermeister Theodor Freiherrn<br />
von Waldkirch errichtet. - Alt aufgezogen, etwas angestaubt, mit feinem Rändchen<br />
um die Einfassungslinie.<br />
370 - Hirschgarten. Radierung von Hieronymus Bayer. Oben<br />
links in <strong>der</strong> Platte monogrammiert „HB“. Um 1820. 8,1 x 10,2 cm.<br />
180,—<br />
Reizendes kleines Blättchen mit dem Eingangstor zu dem beliebten Bier garten.<br />
- Sehr breitrandig und tadellos erhalten.<br />
371 OBERFÖHRING. - „Aussicht des Chfl: Schulhaus zu S:<br />
Emmeram bey Oberföhring nächst <strong>München</strong>.“ Kupferstich,<br />
(1805). 19 x 29,5 cm. 1.800,—<br />
Slg. Proebst 869 (an<strong>der</strong>er Bildtitel); Abb. in „<strong>München</strong> im Wandel <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>te<br />
S.129. - Sehr seltene Ansicht <strong>der</strong> Klause von St. Emmeram bei Oberföhring<br />
(mit einer von Einsiedlern geleiteten Schule, links am Bildrand die Bogenhausener<br />
St. Georgskirche, im Hintergrund die Silhouette von <strong>München</strong>, rechts<br />
oben in den Wolken <strong>der</strong> heilige Emmeram. - Breitrandig und gut erhalten.<br />
45