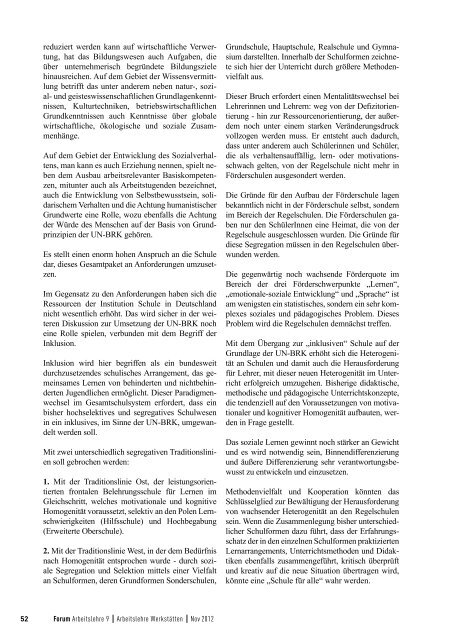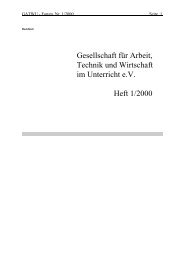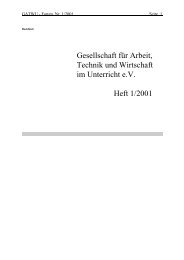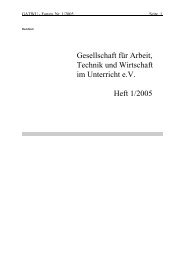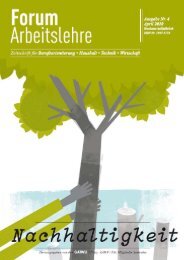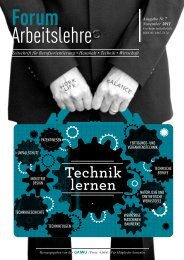2/2012
2/2012
2/2012
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
eduziert werden kann auf wirtschaftliche Verwertung,<br />
hat das Bildungswesen auch Aufgaben, die<br />
über unternehmerisch begründete Bildungsziele<br />
hinausreichen. Auf dem Gebiet der Wissensvermittlung<br />
betrifft das unter anderem neben natur-, sozial-<br />
und geisteswissenschaftlichen Grundlagenkenntnissen,<br />
Kulturtechniken, betriebswirtschaftlichen<br />
Grundkenntnissen auch Kenntnisse über globale<br />
wirtschaftliche, ökologische und soziale Zusammenhänge.<br />
Auf dem Gebiet der Entwicklung des Sozialverhaltens,<br />
man kann es auch Erziehung nennen, spielt neben<br />
dem Ausbau arbeitsrelevanter Basiskompetenzen,<br />
mitunter auch als Arbeitstugenden bezeichnet,<br />
auch die Entwicklung von Selbstbewusstsein, solidarischem<br />
Verhalten und die Achtung humanistischer<br />
Grundwerte eine Rolle, wozu ebenfalls die Achtung<br />
der Würde des Menschen auf der Basis von Grundprinzipien<br />
der UN-BRK gehören.<br />
Es stellt einen enorm hohen Anspruch an die Schule<br />
dar, dieses Gesamtpaket an Anforderungen umzusetzen.<br />
Im Gegensatz zu den Anforderungen haben sich die<br />
Ressourcen der Institution Schule in Deutschland<br />
nicht wesentlich erhöht. Das wird sicher in der weiteren<br />
Diskussion zur Umsetzung der UN-BRK noch<br />
eine Rolle spielen, verbunden mit dem Begriff der<br />
Inklusion.<br />
Inklusion wird hier begriffen als ein bundesweit<br />
durchzusetzendes schulisches Arrangement, das gemeinsames<br />
Lernen von behinderten und nichtbehinderten<br />
Jugendlichen ermöglicht. Dieser Paradigmenwechsel<br />
im Gesamtschulsystem erfordert, dass ein<br />
bisher hochselektives und segregatives Schulwesen<br />
in ein inklusives, im Sinne der UN-BRK, umgewandelt<br />
werden soll.<br />
Mit zwei unterschiedlich segregativen Traditionslinien<br />
soll gebrochen werden:<br />
1. Mit der Traditionslinie Ost, der leistungsorientierten<br />
frontalen Belehrungsschule für Lernen im<br />
Gleichschritt, welches motivationale und kognitive<br />
Homogenität voraussetzt, selektiv an den Polen Lernschwierigkeiten<br />
(Hilfsschule) und Hochbegabung<br />
(Erweiterte Oberschule).<br />
2. Mit der Traditionslinie West, in der dem Bedürfnis<br />
nach Homogenität entsprochen wurde - durch soziale<br />
Segregation und Selektion mittels einer Vielfalt<br />
an Schulformen, deren Grundformen Sonderschulen,<br />
Grundschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium<br />
darstellten. Innerhalb der Schulformen zeichnete<br />
sich hier der Unterricht durch größere Methodenvielfalt<br />
aus.<br />
Dieser Bruch erfordert einen Mentalitätswechsel bei<br />
Lehrerinnen und Lehrern: weg von der Defizitorientierung<br />
- hin zur Ressourcenorientierung, der außerdem<br />
noch unter einem starken Veränderungsdruck<br />
vollzogen werden muss. Er entsteht auch dadurch,<br />
dass unter anderem auch Schülerinnen und Schüler,<br />
die als verhaltensauffällig, lern- oder motivationsschwach<br />
gelten, von der Regelschule nicht mehr in<br />
Förderschulen ausgesondert werden.<br />
Die Gründe für den Aufbau der Förderschule lagen<br />
bekanntlich nicht in der Förderschule selbst, sondern<br />
im Bereich der Regelschulen. Die Förderschulen gaben<br />
nur den SchülerInnen eine Heimat, die von der<br />
Regelschule ausgeschlossen wurden. Die Gründe für<br />
diese Segregation müssen in den Regelschulen überwunden<br />
werden.<br />
Die gegenwärtig noch wachsende Förderquote im<br />
Bereich der drei Förderschwerpunkte „Lernen“,<br />
„emotionale-soziale Entwicklung“ und „Sprache“ ist<br />
am wenigsten ein statistisches, sondern ein sehr komplexes<br />
soziales und pädagogisches Problem. Dieses<br />
Problem wird die Regelschulen demnächst treffen.<br />
Mit dem Übergang zur „inklusiven“ Schule auf der<br />
Grundlage der UN-BRK erhöht sich die Heterogenität<br />
an Schulen und damit auch die Herausforderung<br />
für Lehrer, mit dieser neuen Heterogenität im Unterricht<br />
erfolgreich umzugehen. Bisherige didaktische,<br />
methodische und pädagogische Unterrichtskonzepte,<br />
die tendenziell auf den Voraussetzungen von motivationaler<br />
und kognitiver Homogenität aufbauten, werden<br />
in Frage gestellt.<br />
Das soziale Lernen gewinnt noch stärker an Gewicht<br />
und es wird notwendig sein, Binnendifferenzierung<br />
und äußere Differenzierung sehr verantwortungsbewusst<br />
zu entwickeln und einzusetzen.<br />
Methodenvielfalt und Kooperation könnten das<br />
Schlüsselglied zur Bewältigung der Herausforderung<br />
von wachsender Heterogenität an den Regelschulen<br />
sein. Wenn die Zusammenlegung bisher unterschiedlicher<br />
Schulformen dazu führt, dass der Erfahrungsschatz<br />
der in den einzelnen Schulformen praktizierten<br />
Lernarrangements, Unterrichtsmethoden und Didaktiken<br />
ebenfalls zusammengeführt, kritisch überprüft<br />
und kreativ auf die neue Situation übertragen wird,<br />
könnte eine „Schule für alle“ wahr werden.<br />
52<br />
Forum Arbeitslehre 9 Arbeitslehre Werkstätten Nov <strong>2012</strong>