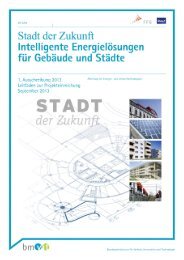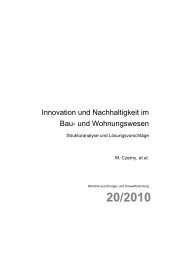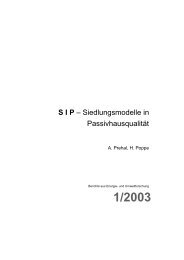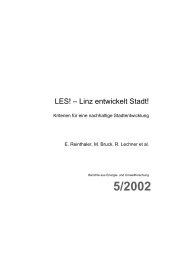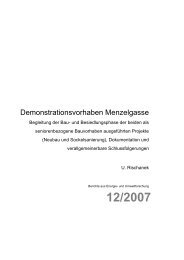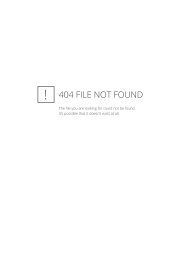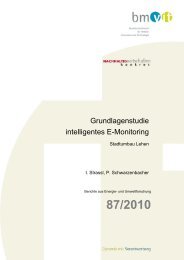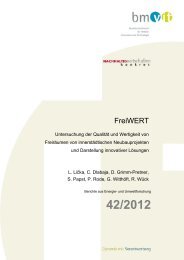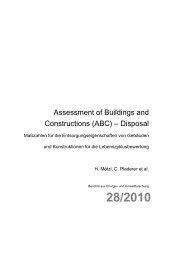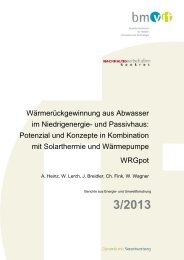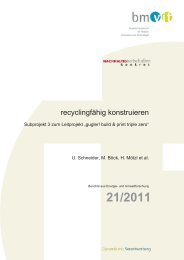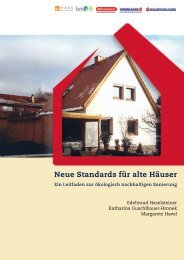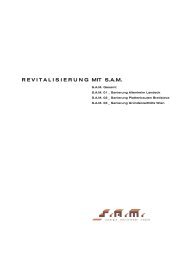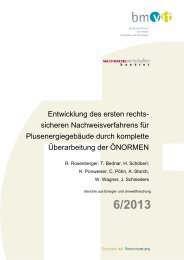Endbericht (1.3 MB) - Haus der Zukunft
Endbericht (1.3 MB) - Haus der Zukunft
Endbericht (1.3 MB) - Haus der Zukunft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ASTTP Forschungsagenda Solarthermie<br />
4.5 Einbindung von Solarwärme in Nah- und Fernwärmenetze<br />
4.5.1 Stand <strong>der</strong> Technik<br />
Rahmenbedingungen bei netzgebundener Wärmeversorgung<br />
Wärmeversorgungsanlagen auf Basis netzgebundener Anlagen haben in<br />
Österreich große Tradition. Sowohl städtische Wärmeversorgungskonzepte (auf<br />
Basis konventioneller Energieträger, Abwärme und KWK), kommunale<br />
Nahwärmenetze (vielfach auf Basis von Biomasse, aber auch Abwärme und<br />
fossile Energieträger) o<strong>der</strong> sogenannte Mikronetze (praktisch alle Energieträger,<br />
u.a. auch Pellets) zur Versorgung von Ortsteilen o<strong>der</strong> Gebäudegruppen sind weit<br />
verbreitet. Auch in <strong>der</strong> zukünftigen Energieversorgung Österreichs wird <strong>der</strong><br />
leitungsgebundenen Wärmeversorgung in verschiedenen Expertenpapieren (u.a.<br />
in <strong>der</strong> aktuell veröffentlichten „Energiestrategie Österreich“, <strong>der</strong> Veröffentlichung<br />
„Entwicklungspotenziale für Fernwärme und Fernkälte in Österreich“) eine<br />
zentrale Rolle zugesprochen. Insbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Erreichung von<br />
Klimaschutzzielen und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger bietet<br />
die leitungsgebundene Wärmeversorgung (zusätzlich zu aktuell bereits<br />
ansprechenden Beiträgen) auch zukünftig erhebliche Chancen und Möglichkeiten.<br />
Vor allem die Integration von neuen Technologien im Bereich erneuerbarer<br />
Energieträger (Solarthermie, Wärmepumpen, Biomasse, dynamisch betriebene<br />
KWK-Anlagen, angepasstes Speichermanagement, etc.) erscheint hier in<br />
Verbindung mit neu überdachten Betriebskonzepten sehr vielversprechend.<br />
Aktueller Stand bei <strong>der</strong> Integration von Solarthermie in Wärmenetze<br />
Aktuell sind im Bereich <strong>der</strong> Integration von Solarthermie in Nah- und<br />
Fernwärmenetze etwa 30 Projekte mit Kollektorflächen zwischen 200 und<br />
5.000 m² realisiert. Waren es über Jahre hauptsächlich Anlagen im Bereich von<br />
kommunalen Nahwärmenetzen (Eibiswald, 1.250 m² Kollektorfläche; Winklern,<br />
<strong>1.3</strong>00 m² Kollektorfläche etc.) wurden in den letzten Jahren auch Anlagen zur<br />
Einspeisung in städtische Wärmenetze (1.400 m² Kollektorfläche auf <strong>der</strong> UPC-<br />
Arena in Graz, 5.000 m² Kollektorfläche am Dach des Fernheizwerkes AEVG,<br />
Graz; 3.000 m² Kollektorfläche am Dach des Welser Messezentrums; etc.)<br />
errichtet. Zusätzlich gewinnt die Anwendung von kleineren solarthermischen<br />
Anlagen im Bereich von Mikronetzen (zahlreiche Projekte mit Kollektorflächen<br />
zwischen 30 und 500 m²) zunehmend an Bedeutung.<br />
4.5.2 Kernbereiche für technologische Entwicklung<br />
Im Vor<strong>der</strong>grund steht die Fragestellung, wie konventionelle fossile Energieträger<br />
in leitungsgebundenen Wärmeversorgungsanlagen größtenteils durch<br />
Solarenergie und gesteigerter Abwärmenutzung sowie durch an<strong>der</strong>e erneuerbare<br />
Energien substituiert werden können. Im Bereich von biomassebefeuerten<br />
Wärmenetzen gilt es zu klären, inwieweit Solarwärme größtenteils die Deckung<br />
des Wärmebedarfs in den Sommermonaten übernehmen kann und somit<br />
Teillastbetrieb von Biomassekesseln bzw. auch <strong>der</strong> Einsatz von fossil befeuerten<br />
Schwachlastkesseln vermieden werden kann. Gefragt sind daher ganzheitliche<br />
51