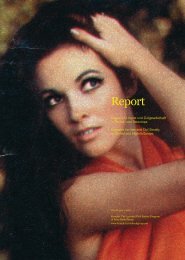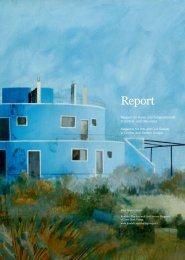Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Analyse über das Land schreiben wolle. Allein<br />
durch eine solche Anfrage kam man schon in<br />
die Akten rein. Kollegen warnten mich, ich<br />
solle um Gottes willen nichts Schriftliches aus<br />
der Hand geben, sonst würde man mir daraus<br />
sofort einen Strick drehen. An diesen Rat hielt<br />
ich mich.<br />
„Gute Quellen, auf die wir<br />
Journalisten zurückgreifen<br />
können, sind kritische NGOs<br />
vor Ort“<br />
Stimmt es, dass Sie einmal sinngemäß gesagt<br />
haben: „In den Osten darf man nur politisch Linke<br />
schicken, das sind die schärferen Kritiker“?<br />
B. C.-K.: Das habe nicht ich, sondern der ehemalige<br />
ORF-Intendant Gerd Bacher gesagt,<br />
ein großer Kommunistenfresser. Er hatte mich<br />
Anfang der siebziger <strong>Jahre</strong> für die Osteuroparedaktion<br />
des ORF engagiert. Ich habe ihm<br />
gesagt, ich sei aber mit einem Mitglied des<br />
Politbüros der KPÖ verheiratet. Gerd Bacher<br />
antwortete nur: „Das ist gut so!“ Bei meiner Arbeit<br />
war die private Verbindung zu einem Reformkommunisten,<br />
wie es mein Mann war. natürlich<br />
eher von Nachteil. Davon wusste auch<br />
kaum jemand im Osten, bestenfalls vielleicht<br />
die Geheimdienste.<br />
War der ORF bei der Osteuropaberichterstattung<br />
überdurchschnittlich engagiert?<br />
B. C.-K.: In meiner Zeit in der Osteuroparedaktion<br />
des ORF vor der Wende tat sich politisch<br />
in den Ländern oft nicht besonders viel. Mich<br />
interessierte eher das Leben in den Ländern,<br />
die so unmittelbar an Österreich angrenzten,<br />
unabhängig vom Regime. Der ORF war damals<br />
auch allen Vorschlägen gegenüber sehr offen.<br />
M. K.: Wenn dann etwas passierte, war es bestimmt<br />
ein unglaublicher Vorteil, Leute in der<br />
Redaktion sitzen zu haben, die sich in den Ländern<br />
schon auskannten.<br />
B. C.-K.: Richtig. Kurz bevor die Solidarnośćbewegung<br />
Ende der Sechziger ihren Lauf nahm,<br />
war ich in Polen und traf Adam Michnik, der<br />
ja viele <strong>Jahre</strong> im Gefängnis saß. Er verriet mir,<br />
dass sie jetzt freie Gewerkschaften durchzusetzen<br />
gedächten. Ausgerechnet das, dachte ich<br />
mir, das werden die nie zulassen. Wenig später<br />
kam eine Meldung beim ORF rein – mit Telex,<br />
das war eine Art Papierstreifen – und ich las:<br />
„Streik in der Danziger Werft – eine der Forde-<br />
rungen: freie Gewerkschaften!“ Ich fuhr sofort<br />
los. Wir waren unter den Ersten von der Auslandspresse<br />
und ich kannte dort schon einige<br />
Leute. Unsere Radiogeschichten sind dann im<br />
ganzen deutschen Sprachraum nachgespielt<br />
worden. Daraufhin kam Gerd Bacher auf die<br />
Idee, eine Osteuroparedaktion im ORF zu<br />
gründen.<br />
Gab es Quellen aus den Ostblockländern, auf<br />
die man im Westen regelmäßig zurückgreifen<br />
konnte?<br />
B. C.-K.: Gute Informanten waren die Emigranten,<br />
von denen nach dem Jahr 1968 viele in<br />
Wien lebten. Eine ganz wichtige Quelle war das<br />
„Radio Free Europe“. Die hatten ihre Leute vor<br />
Ort, sie verfolgten die Medienberichterstattung<br />
in den Ländern intensiv und hatten beispielsweise<br />
Wirtschaftszahlen parat, an die wir nie<br />
rangekommen wären. Ihre sogenannten Research-Materialien<br />
waren eine unverzichtbare<br />
Quelle.<br />
Da hat man es heute in Zeiten des Internets<br />
schon leichter, oder?<br />
M. K.: Die offiziellen Quellen der Regierungen<br />
kann man heute größtenteils immer noch nicht<br />
verwenden, weil die ehemaligen Ostblockstaaten<br />
und die Länder Ex-Jugoslawiens mitunter<br />
dazu neigen, sich ihr Land schönzureden. Gute<br />
Quellen, auf die wir Journalisten zurückgreifen<br />
können, sind oft die kritischen NGOs vor Ort,<br />
wie das Helsinki-Komitee für Menschenrechte,<br />
Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa,<br />
Institutionen, die dort am Aufbau der Zivilgesellschaften<br />
beteiligt sind. Sie sind verlässliche<br />
Quellen, weil sie oft in Opposition zu dem stehen,<br />
was dort offiziell politisch passiert.<br />
Wird nicht auch von den Regierungen im Westen<br />
beschönigt?<br />
M. K.: Mein Eindruck ist, ja. Auch in Wien habe<br />
ich diese Erfahrung während meiner Recherchen<br />
gemacht. Wenn man etwa beim Innenministerium<br />
anruft und offizielle Zahlen über<br />
Islamisten haben möchte, bekommt man keine<br />
Antwort, obwohl Staatsanwälte und Polizei in<br />
Bosnien davor warnen, dass radikales Gedankengut<br />
aus Wien nach Bosnien exportiert würde.<br />
In Österreich stößt man als Journalist teilweise<br />
auf Widerstände, die man in einer westlichen<br />
Demokratie so nicht erwarten würde.<br />
Berichten österreichische und deutsche Medien<br />
anders über Osteuropa?<br />
M. K.: Auf jeden Fall. Die österreichischen Medien<br />
berichten ausführlicher und regelmäßiger<br />
aus Ost- und Südosteuropa als die deutschen.<br />
Das liegt an den familiären Verknüpfungen, die<br />
es in Österreich immer noch gibt; an dem gemeinsamen<br />
k. u. k.-Erbe, aber natürlich auch<br />
an den neuen wirtschaftlichen Vernetzungen.<br />
Es gibt in Österreich ein vitales wirtschaftliches<br />
Interesse an dieser Region. Und man ist geografisch<br />
schlicht und einfach näher dran.<br />
Marion Kraske, geboren 1969, hat Politikwissenschaft,<br />
Wirtschaftspolitik und Slawistik studiert. Nach einem<br />
Volontariat bei der Deutschen Presse-Agentur arbeitete<br />
sie als Redakteurin bei der „Tagesschau“ in der ARD.<br />
<strong>20</strong>02 wechselte sie zu „Spiegel online“, ein Jahr später<br />
in die Auslandsredaktion des deutschen Nachrichtenmagazins.<br />
Von <strong>20</strong>05 bis <strong>20</strong>08 Korrespondentin des<br />
„Spiegels“ in Wien, zuständig für Österreich und Südosteuropa,<br />
seither freie Autorin und Publizistin.<br />
Barbara Coudenhove-Kalergi wurde 1932 in Prag geboren<br />
und lebt seit ihrer Vertreibung aus der Heimat im<br />
Jahr 1945 in Wien. Sie schrieb als Journalistin für die<br />
„Arbeiter-Zeitung“, „Die Presse“, „Neues Österreich“,<br />
„Kurier“ und „profil“. Ab 1975 arbeitete sie in der Osteuroparedaktion<br />
des ORF, für den sie von 1991 bis 1995<br />
als Korrespondentin aus Prag berichtete. Dem breiteren<br />
österreichischen Publikum war sie bereits durch ihre<br />
<strong>Report</strong>agen, vor allem aus Polen und der Tschechoslowakei,<br />
im Österreichischen Rundfunk bekannt.<br />
Heute schreibt sie als freie Journalistin für verschiedene<br />
tschechische und österreichische Zeitungen (u. a. „Der<br />
Standard“) und ist Herausgeberin mehrerer Bücher mit<br />
Texten zur Geschichte und Gegenwart der Länder Osteuropas.<br />
Von Václav Havel wurde sie <strong>20</strong>01 mit dem Orden<br />
von Tomáš Garrigue Masaryk ausgezeichnet. Sie ist Mitbegründerin<br />
der Bürgerinitiative „Land der Menschen“,<br />
die sich für ein besseres Zusammenleben von In- und<br />
Ausländern einsetzt.<br />
Buchtipps<br />
Barbara Coudenhove-Kalergi, Oliver Rathkolb (Hrsg.),<br />
„Die Beneš-Dekrete“, Czernin Verlag, Wien <strong>20</strong>02<br />
Barbara Coudenhove-Kalergi (Hrsg.), „Meine Wurzeln<br />
sind anderswo (Österreichische Identitäten)“, Czernin<br />
Verlag, Wien <strong>20</strong>01<br />
Marion Kraske, „Ach Austria! Verrücktes Alpenland“,<br />
Molden Verlag, Wien <strong><strong>20</strong>09</strong><br />
Erschienen im „<strong>Report</strong>“ im September <strong>20</strong>08 (online)<br />
23