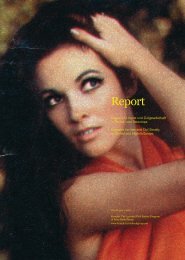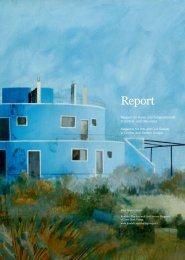Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„ BEI MIR GIBT<br />
ES ETWAS …“<br />
Die vorliegende Bildserie, die der Wiener Fotograf Wolf-Dieter Grabner für „<strong>Report</strong>“ gestaltet<br />
hat, zeigt sowjetische Alltagsgegenstände, die die Russin Ella Opalnaja jahrzehntelang zusammengetragen<br />
hat. Im Sommer <strong><strong>20</strong>09</strong> wurden diese im Rahmen der Diplomarbeit von Ekaterina<br />
Shapiro-Obermair an der Akademie der bildenden Künste in Wien das erste Mal der Öffentlichkeit<br />
präsentiert.<br />
— Ekaterina Shapiro-Obermair —<br />
Das Wort Gegenstand heißt auf Russisch<br />
„Vešč“ . Etymologisch hat es seinen Ursprung<br />
im Verb „veščat“, „sprechen“. Es lässt sich bis<br />
zu den heidnischen Riten der slawischen Völker<br />
zurückführen. Deren Vorstellungen nach<br />
waren rituelle Gegenstände mit der göttlichen<br />
Fähigkeit der Prophezeiung beseelt. Diese besondere<br />
Beziehung zum Objekt, dem Subjekteigenschaften<br />
zugeschrieben werden, ist für die<br />
russische Kultur immer noch charakteristisch.<br />
So spiegelt sie sich auch in der heutigen russischen<br />
Sprache wider: Die grammatikalische<br />
Form „Ich habe etwas“ ist zwar möglich, wird<br />
dennoch kaum gebraucht und im Russischen<br />
durch die Redewendung „Bei mir gibt es etwas“<br />
ersetzt.<br />
In den vergangenen drei <strong>Jahre</strong>n sind sowjetische<br />
Gebrauchtgegenstände mehr und mehr<br />
zu beliebten Sammlerobjekten geworden. Aber<br />
etwas ganz Besonderes stellt die Sammlung<br />
von Ella Opalnaja dar, einer Dissidentin aus<br />
Moskau, die heute in Düsseldorf lebt. Auslöser<br />
für ihre manische Sammelleidenschaft war die<br />
erzwungene Ausreise aus ihrer sowjetischen<br />
Heimat.<br />
1980 wurde Moskau vor Beginn der Olympischen<br />
Spiele von allen sogenannten „asozialen<br />
Elementen“ gesäubert: vorbestraften Personen,<br />
Prostituierten, Menschen ohne Anmeldung.<br />
Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch<br />
politisch nicht konforme Bürger der Stadt oder<br />
sogar des Landes verwiesen wurden. Unter<br />
ihnen waren viele Juden, die bereits seit den<br />
frühen 1970er <strong>Jahre</strong>n wegen permanenter Repressalien<br />
eine Emigration aus der Sowjetunion<br />
anstrebten. Auch Ella Opalnaja und ihre Familie<br />
mussten aufgrund ihrer Herkunft und ihres<br />
bürgerlichen Engagements das Land schnell<br />
verlassen. Ihre erste Station im Westen war –<br />
wie bei so vielen anderen jüdischen Migranten<br />
auch – Wien. Von hier aus ging es für die meisten<br />
von ihnen weiter, in der Regel in Richtung<br />
Israel oder USA. Die Familie von Ella Opalnaja<br />
entschied sich, nach Deutschland auszuwandern.<br />
Wie schwierig dieser Weg werden würde,<br />
ahnten sie damals nicht: Der Vater sollte die<br />
18-jährige Tochter bis nach New York zu ihrem<br />
Freund begleiten, um sich später seiner Frau<br />
und dem neunjährigen Sohn in Deutschland<br />
anzuschließen. Die Familie verabschiedete sich<br />
nur flüchtig, man ahnte damals nicht, dass fünf<br />
<strong>Jahre</strong> vergehen sollten, bis der Familienvater<br />
die Erlaubnis für eine Einreise in die BRD zu<br />
seiner Familie erhalten würde.<br />
Die Emigranten mussten nicht nur ihre Wohnungen<br />
und das komplette Mobiliar zurücklassen,<br />
sondern im Grunde fast alles, was sie<br />
besaßen. Bei der Ausreise aus der Sowjetunion<br />
wurden die Anzahl und die Art der Gegenstände<br />
strengstens reglementiert und kontrolliert.<br />
Es war auch klar, dass man nach dem Entzug<br />
der sowjetischen Staatsbürgerschaft nie mehr<br />
wieder zurück in das Heimatland reisen können<br />
würde.<br />
Doch es kam alles anders: Das Jahr 1989 brachte<br />
die Wende. Kurz nach dem Fall der Mauer<br />
fuhr Ella Opalnaja nach Moskau – trotz ihrer<br />
latenten Angst, nicht mehr ausreisen zu dürfen,<br />
wenn nicht sogar verhaftet zu werden. Schließlich<br />
sollte die UdSSR noch zwei <strong>Jahre</strong> weiter<br />
existieren. Während ihrer Abwesenheit hatte<br />
sich vieles verändert: Dinge, die noch vor Kurzem<br />
unvorstellbar gewesen wären, ereigneten<br />
sich nun sogar in aller Öffentlichkeit. Besonders<br />
augenfällig erschien Ella Opalnaja die Abneigung<br />
der Menschen gegenüber den Artefakten<br />
der sowjetischen Kultur. Ihr wurde bewusst,<br />
dass mit dem Verlust dieser Dinge eine ganze<br />
geschichtliche Periode in Vergessenheit geraten<br />
würde. Ab diesem Zeitpunkt begann sie systematisch<br />
russische und sowjetische Gegenstände<br />
zu sammeln. Teilweise erwarb sie ein Stück<br />
jedes Exemplars aus dem gesamten Sortiment<br />
alter sowjetischer Geschäfte, die es heute großteils<br />
nicht mehr gibt. Sie bat Freunde, Bekannte<br />
und Nachbarn, ihr nicht mehr benötigte Sachen<br />
aus den „alten Zeiten“ zu überlassen. Auf der<br />
Straße, auf Flohmärkten oder in Abfalltonnen<br />
fand Ella Opalnaja Objekte für ihre Sammlung.<br />
Anfangs versuchte sie, durch die Gegenstände<br />
ihre einst verlorene Umgebung zu rekonstruieren.<br />
Heute verfolgt sie vielmehr den wissenschaftlichen<br />
Anspruch, die vergehende und vergangene<br />
Epoche zu dokumentieren. Hilfreich<br />
war dabei ihr akademischer Background und<br />
ihr von Anfang an künstlerisch-intellektuelles<br />
Umfeld: Bereits vor der Oktoberrevolution 1917<br />
hatten ihre Eltern der reicheren und gebildeten<br />
Schicht angehört. Ihr Mann war Maler, ihre<br />
Freunde waren Künstler, Dichter, Literaten.<br />
Sie selbst studierte Philologie und Schauspiel,<br />
arbeitete als Museumskustodin und Theaterregisseurin.<br />
Heute sieht sie sich vorrangig als<br />
Installations- und Performancekünstlerin.<br />
Ella Opalnaja lebt derzeit in Düsseldorf. Ihr<br />
Zuhause wirkt wie ein russisch-sowjetisches<br />
Museum, vom Boden bis zur Decke voll geräumt<br />
mit verschiedenen Ausstellungsstücken.<br />
Innerhalb der Wohnung sind die Gegenstände<br />
thematisch geordnet: Im Bad befindet sich<br />
alles zum Thema „Wasser“, in der Küche zum<br />
Thema „Essen“, im Schlafzimmer hängen alte<br />
Kleidungsstücke. Zudem besitzt die Sammlerin<br />
ein kleines Depot, in dem die Objekte in<br />
sorgfältig beschrifteten Schachteln verpackt<br />
gelagert werden. Neben den Gebrauchsgegenständen,<br />
die den Schwerpunkt ihrer Sammlung<br />
bilden, nennt sie viele seltene und einzigartige<br />
historische Dokumente wie Parteibriefe aus<br />
den 19<strong>20</strong>ern und Lebensmittelkarten aus Leningrad<br />
während der Blockade ihr Eigen. Ein<br />
„richtiges“ Museum für ihre unzähligen Objekte<br />
ist ihr sehnlichster Traum.<br />
Ich selbst habe Ella Opalnaja über ihren Sohn,<br />
den Dichter Alexander Nitzberg, kennengelernt.<br />
Als ich ihm erzählte, dass ich mich mit<br />
sowjetischen Alltagsgegenständen beschäftige,<br />
meinte er, ich sollte unbedingt seine Mutter<br />
kennenlernen. Zwischen mir und Ella entstand<br />
– trotz eines Altersunterschiedes von 45 <strong>Jahre</strong>n<br />
– nicht nur eine warme freundschaftliche<br />
Beziehung, sondern auch eine Arbeitsgemeinschaft<br />
auf Zeit. Ich präsentierte einen Teil ihrer<br />
Sammlung im Rahmen meiner Installation<br />
„Corpus Delicti“, die gleichzeitig meine Abschlussarbeit<br />
an der Akademie der bildenden<br />
Künste Wien war. Im Zentrum der Installation<br />
steht der Begriff „des sowjetischen Gegenstandes“,<br />
der auf verschiedenste Art und Weise – in<br />
Zeichnungen und Collagen, gefundenen Objekten<br />
und einer von mir speziell entworfenen<br />
Ausstellungsarchitektur – dekliniert wird. Der<br />
Schwerpunkt meiner künstlerischen Auseinandersetzung<br />
liegt im Versuch, das Tätigkeitsfeld<br />
des Künstlers hin zur Kuration, zum Ausstellungsdesign,<br />
der Architektur, der Kulturologie<br />
und Ethnografie zu erweitern.<br />
Ekaterina Shapiro-Obermair (geboren 1980 in Moskau)<br />
ist bildende Künstlerin. 1998 Übersiedlung in die<br />
Bundesrepublik Deutschland. Studium der Malerei an<br />
der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Weiterführende<br />
Studien in den Bereichen Fotografie, performative<br />
Kunst und Bildhauerei an der Universität der<br />
Künste Berlin, Universität für angewandte Kunst Wien<br />
und der Akademie der bildenden Künste Wien. Seit<br />
<strong>20</strong>04 lebt und arbeitet Ekaterina Shapiro-Obermair in<br />
Wien. Von <strong>20</strong>05 bis <strong>20</strong>08 organisierte und realisierte<br />
sie in Kooperation mit der Galerie Knoll Wien/Budapest<br />
eine Reihe von Exkursionen nach Moskau, die den russischen<br />
Kunstmarkt und die freie Kunst- und Kulturszene<br />
zum Thema hatten. <strong>20</strong>08 veröffentlichte sie zusammen<br />
mit Wolfgang Obermair den Band „Das große Moskau,<br />
das es niemals gab“ (erschienen bei Schlebrügge Editor,<br />
Wien).<br />
Für ihre Installation „Corpus Delicti“ wurde sie <strong><strong>20</strong>09</strong><br />
mit dem Würdigungspreis der Akademie der bildenden<br />
Künste Wien ausgezeichnet.<br />
www.ekaterina-obermair.de<br />
“ AT ME THERE<br />
IS SOMETHING …”<br />
This series of images taken by Viennese photographer Wolf-Dieter Grabner for “<strong>Report</strong>”<br />
shows everyday Soviet objects that the Russian Ella Opalnaja collected over a period of<br />
decades. In summer <strong><strong>20</strong>09</strong> they were publicly presented for the first time in the framework<br />
of a thesis project by Ekaterina Shapiro-Obermair at the Academy of Fine Arts .<br />
— Ekaterina Shapiro-Obermair —<br />
The Russian word for object is “Vešč”. Etymologically<br />
its root is in the verb “veščat”, “to<br />
speak”. It can be traced back to the pagan rites<br />
of the Slav peoples. In their understanding ritual<br />
objects were endowed with the divine gift<br />
of prophesy. This special relationship to the<br />
object, to which subjective qualities are attributed,<br />
is still characteristic of Russian culture.<br />
This is also reflected in the Russian language<br />
today: although the grammatical form “I have<br />
something” is possible it is hardly ever used, in<br />
Russian the form generally used is “at me there<br />
is something”.<br />
In the last three years Soviet objects have increasingly<br />
become collectors’ objects. But the<br />
collection of Ella Opalnaja, a dissident from<br />
Moscow who today lives in Düsseldorf, is something<br />
special. Her obsessive passion for collecting<br />
started when she was expelled from her native<br />
Soviet home.<br />
In 1980, before the start of the Olympic Games,<br />
Moscow was cleansed of all so-called “antisocial<br />
elements”; persons with a criminal record,<br />
prostitutes, unregistered persons. Less<br />
well-known is the fact that citizens who did<br />
not confirm were expelled from the city or indeed<br />
even from the country. Among these were<br />
many Jews who, due to permanent backlashes,<br />
had sought since the 1970s to emigrate from<br />
the Soviet Union. Ella Opalnaja and her family<br />
also had to leave the country quickly, due to<br />
their origins and civic involvement. Like with<br />
so many other Jewish migrants their first stop<br />
in the West was Vienna. From here most travelled<br />
further – to Israel or the USA . Ella Opalnaja’s<br />
family, however, decided to emigrate to<br />
Germany. At that time they had no idea how<br />
difficult this path would be. The father was to<br />
accompany the eighteen-year-old daughter<br />
as far as New York to her boyfriend, and then<br />
later to join his wife and the nine-year old son<br />
in Germany. The family took leave of each other<br />
hastily, never knowing that it was to take five<br />
years until the father received a permit to enter<br />
the BRD to join his family.<br />
The emigrants had to leave behind not only<br />
their apartments and all their furniture but essentially<br />
everything that they owned. On leaving<br />
the Soviet Union the number and kind of<br />
objects was strictly regulated and checked. And<br />
it was clear that, after renouncing Soviet citizenship,<br />
they could never return to their native<br />
country.<br />
But things turned out differently. 1989 brought<br />
along the major political change in Europe.<br />
After the fall of the Berlin Wall Ella Opalnaja<br />
travelled to Moscow – despite her latent fear<br />
that she would not be allowed to leave again or<br />
might even be arrested – the USSR was to exist<br />
for another two years. During her absence a<br />
great deal had changed: things that only a short<br />
time previously would have been unimaginable,<br />
now took place in public. Ella was particularly<br />
struck by people’s dislike of artefacts of Soviet<br />
culture. She became aware that with the loss of<br />
these things an entire historical period would be<br />
forgotten. From this time onwards she begain<br />
to collect Russian and Soviet objects systematically.<br />
She attempted to buy one example of all<br />
items in the entire range in old Soviet shops that<br />
today, for the most part, no longer exist. She<br />
asked friends, acquaintances and neighbours to<br />
give her things from the “old days” that they no<br />
longer needed. She found objects for her collection<br />
on the street, at flea-markets or in rubbish<br />
bins. Initially she attempted to use the objects<br />
to reconstruct their lost setting. Today she follows<br />
a more scientific aim of documenting past<br />
and vanishing epochs. Her academic and artistic-intellectual<br />
background were an aid to her<br />
from the start: before the October Revolution<br />
in 1917 her parents belonged to the wealthier,<br />
educated class. Her husband was painter, her<br />
friends included artists, poets, writers. She herself<br />
studied philosophy and acting, worked as<br />
a museum custodian and theatre director. Today<br />
she sees herself more as an installation and<br />
performance artist.<br />
Ella Opalnaja currently lives in Düsseldorf. Her<br />
home seems like a Russian-Soviet museum,<br />
filled from floor to ceiling with various exhibits.<br />
In the apartment the objects are ordered<br />
according to theme: in the bathroom there is<br />
everything to do with the theme “water”, in the<br />
kitchen things to do with the theme “eating”,<br />
old items of clothing hang in the bedroom. In<br />
addition she owns a small depot in which the<br />
objects stored are packed in carefully labelled<br />
boxes. In addition to the useful objects that<br />
form the focus of her collection she also owns<br />
many rare and unique historic documents,<br />
such as Party letters from the 19<strong>20</strong>s and food<br />
cards from Leningrad during the blockade. Her<br />
greatest dream is a “proper” museum for her<br />
countless objects.<br />
I myself met Ella Opalnaja through her son,<br />
the poet Alexander Nitzberg. When I told him<br />
that I was interested in everyday Soviet items<br />
he said I had to meet his mother. Despite a difference<br />
in age of 45 years not only did a warm<br />
friendship develop between myself and Ella but<br />
also a working collaboration for a certain period.<br />
I presented a part of her collection in the<br />
framework of my installation “Corpus Delicti”,<br />
my graduation thesis project at the Academy<br />
of Fine Arts. At the centre of the installation is<br />
the notion of “the Soviet object” that is declined<br />
in very different ways – in drawings and collages,<br />
found objects and an exhibition architecture<br />
that I specially designed. The focal point<br />
of my artistic examination lies in an attempt to<br />
expand the artist’s area of activity to curating,<br />
exhibition design, architecture, culturology and<br />
ethnography.<br />
Ekaterina Shapiro-Obermair (born in Moscow in 1980)<br />
is an artist. In 1998 she moved to the Federal Republic<br />
of Germany. She studied painting at the Academy of<br />
Fine Arts in Nuremberg. She undertook further studies<br />
in the areas of photography, performative art and sculpture<br />
at the Academy of Fine Arts in Vienna. Since <strong>20</strong>04<br />
she has lived and worked in Vienna. Between <strong>20</strong>05 and<br />
<strong>20</strong>08, in collaboration with the Knoll Gallery Vienna/Budapest,<br />
she organised and carried out a series of excursions<br />
to Moscow based on the theme of the Russian art<br />
market and the free art and culture scenes. In <strong>20</strong>08, together<br />
with Wolfgang Obermair she published the book<br />
“Das große Moskau, das es niemals gab” (published by<br />
Schlebrügge Editor, Vienna).<br />
For her installation “Corpus Delicti” she received the<br />
recognition award of the Academy of Fine Arts Vienna<br />
in <strong><strong>20</strong>09</strong>.<br />
www.ekaterina-obermair.de<br />
47