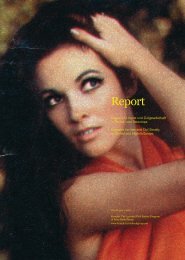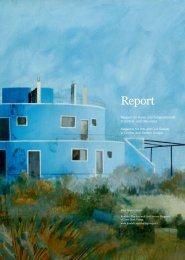Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
— Mircea Cărtărescu —<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1989 war ich 33 <strong>Jahre</strong> alt. Ich war im Kommunismus geboren worden und glaubte, ich<br />
würde auch im Kommunismus sterben. Ich hatte Rumänien nie verlassen, besaß nicht einmal<br />
einen Pass. Ebenso glaubte ich, dass ich niemals irgendwohin ins Ausland verreisen würde. Man<br />
hatte mir nicht erlaubt, mich um eine Stelle an der Universität zu bewerben oder eine Doktorarbeit<br />
zu schreiben. Ich war Lehrer an einer Grundschule in Bukarest, und alle meine Chancen bestanden<br />
darin, von dieser Arbeitsstelle aus dereinst in Rente zu gehen. Wir lebten in einer Wohnung<br />
auf der achten Etage eines Wohnblocks, in dem es keine einzige Wand gab, die zu einer anderen<br />
in einem rechten Winkel stand. Die Welt schien in ihrer Widerwärtigkeit und Vorhersehbarkeit<br />
erstarrt zu sein. Der Kommunismus war die Realität. Alles andere waren Phantasmagorien aus<br />
amerikanischen Filmen.<br />
Die Revolution hat uns überrascht und wir glaubten an sie. Wenn du dich in einer Masse von einer<br />
Million Menschen befindest, die sich umarmen und vor Glück weinen, fragst du nicht mehr,<br />
wer sie zusammengeführt hat und aus welchem Grund. Von all diesen sind tausend erschossen<br />
worden und gestorben. Dann wurde auch Nicolae Ceaus¸escu erschossen, den ich tatsächlich für<br />
unsterblich gehalten hatte.<br />
All dies wurde im Fernsehen gezeigt. Eigentlich handelte es sich um einen fortlaufenden Film,<br />
der ein paar Wochen lang für Exaltationen und Verstörungen sorgte. Doch obwohl alles bestens<br />
erkennbar war, obwohl die Effekte oberflächlich gesetzt waren, obwohl die Kulissen billig und die<br />
Dialoge klischeehaft waren, obwohl man die Schnüre gut erkennen konnte, die den Illusionisten<br />
in einer falschen Schwebe hielten, glaubten wir mit offenen Augen an jenen Traum. Die Revolution<br />
war unsere Telenovela, unsere sirupartige Illusion. Auch heute kann ich es mir noch nicht<br />
verzeihen, daran geglaubt zu haben, denn in einer normalen Welt hätten nicht einmal die Kinder<br />
daran geglaubt. Aber ich wünschte zu sehr, es möge wahr sein.<br />
1990 traten wir in die freie und demokratische Welt, ohne zu wissen, was Freiheit und Demokratie<br />
sind. Nach 50 <strong>Jahre</strong>n faschistischer und kommunistischer Diktaturen waren wir kein Volk, keine<br />
Gesellschaft mehr. Wir waren eine Horde. Die kommunistische Diktatur setzte sich unter einem<br />
durchsichtigen Spitznamen fort. Davor sind wir belogen worden, nun wurden wir belogen. Davor<br />
waren wir arm, nun waren wir noch ärmer. Mein Gehalt an der Universität betrug umgerechnet<br />
50 Dollar pro Monat. Meine Frau war arbeitslos und wir hatten ein kleines Kind. Die Inflation war<br />
grauenhaft, sie zersetzte uns wie ein Schwefelsäurebad. Bald hatten wir überhaupt nichts mehr.<br />
Aber erst als ich meinen Tischtennisschläger verkaufte, merkte ich, wie tief gesunken wir waren.<br />
An einem fantastisch milden Herbsttag bestieg ich die Straßenbahn zum Trödelmarkt in Colentina.<br />
Die Bahn war sehr viel voller, als es sich jemand in der normalen Welt vorstellen kann. Die<br />
Türen waren während der Fahrt offen, die Menschen hingen an den Haltestangen, standen auf<br />
den Stufen, hatten die Puffer bestiegen. Im Grunde war die Bahn von einer Traube von Männern<br />
und Frauen bedeckt, die zum Markt wollten.<br />
Die neunziger <strong>Jahre</strong>, die elendsten <strong>Jahre</strong>, die ich jemals erlebt habe, werden in meinem Kopf stets<br />
mit dem Trödelmarkt verbunden bleiben, zu dem die Straßenbahnen von morgens früh um sechs<br />
an Hunderte, Tausende, Zehntausende Menschen brachten, die alle Gegenstände kaufen und verkaufen<br />
wollten, welche normalerweise in Mülltonnen gehört hätten. Man kann sich den Dreck<br />
und den Staub und die Fäkalgerüche nicht vorstellen, in die man dort eintauchte, dabei war man<br />
allseits zwischen Menschen eingezwängt, die sich gegenseitig auf die Füße traten. Auf dem Boden,<br />
auf zerknitterten Zeitungen voll mit Fotos nackter Frauen lagen krumme Schraubenzieher, zerfledderte<br />
Bücher, triefäugige, eben geborene Kätzchen, gefälschte Parfums, Puppen, deren Beine<br />
herausgerissen waren, leere Kugelschreiberminen, Schallplatten mit Volksmusik, speckige Kleidungsstücke<br />
mit aufgeplatzten Nähten, Besteck, mit dem man nie und nimmer gegessen hätte,<br />
Stecker, Lampen, Drähte, Nägel, alte Fotos, morsche Ikonen, mechanisches Werkzeug, das man<br />
unmöglich identifizieren konnte, und eine Million weiterer Gegenstände. Unrasierte Gestalten<br />
verkauften dies, dicke Frauen mit Kopftüchern, Zigeuner, bis aufs Skelett abgemagerte Kinder<br />
wie in Biafra. Dort, in jenem dantesken Strom, der ohne Unterlass unter dem melancholischen<br />
Herbsthimmel dahinzog, habe auch ich, ein Schriftsteller, der schon mehrere Bücher veröffentlicht<br />
hatte, mittlerweile Hochschullehrer, die übliche Zeitung ausgebreitet und den einzigen Gegenstand<br />
darauf gelegt, den ich verkaufen konnte: meinen alten, geliebten Tischtennisschläger, mit dem ich<br />
einige Turniere gewonnen hatte. Ich hoffte im Grunde, keinen Käufer zu finden, aber bis zur Gehaltsauszahlung<br />
waren es noch zwei Tage, an denen wir wenigstens etwas Brot brauchten.<br />
Und es ward Abend und es ward Morgen. Mein Schläger war schon abgestumpft von Millionen<br />
von Blicken, als endlich jemand, nachdem er ihn in der Hand gewogen und ein paar imaginäre<br />
Zelluloidbälle damit geschlagen hatte, das Geld aus der Tasche zog und mit ihm davonging. Wir<br />
falteten die Zeitung zusammen und wandten uns ebenfalls dem Ausgang zu. Trockene Blätter<br />
schneiten auf uns herab. Der Wind mischte uns den Staub unters Haar. Neben dem Ausgang<br />
kramte ich in einem Haufen Schallplatten in zerschlissenen Hüllen, hinter dem ein Typ mit einer<br />
54<br />
Punk-Frisur stand. Das ganze Geld, das ich für den Tischtennisschläger bekommen hatte, ging für<br />
drei Platten drauf: „Blonde on Blonde“ von Bob Dylan, John Lennons „Mind Games“ und „The<br />
Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd. Mit den Platten unterm Arm zog ich glücklich ab, dabei<br />
hatte ich das Brot ebenso vergessen wie die Tatsache, dass wir nichts besaßen, worauf wir sie uns<br />
hätten anhören können.<br />
Diese Platten besitze ich auch heute noch. Es ist mir nie gelungen, den üblen Geruch von ihnen<br />
zu vertreiben. Sie riechen nach den neunziger <strong>Jahre</strong>n in Rumänien, nach Angst, Unsicherheit und<br />
Verzweiflung. Ich habe sie mir nie angehört.<br />
Dann kamen die Bergarbeiter nach Bukarest. Einmal, zweimal, dreimal, insgesamt sechsmal. Ich<br />
sah die Straßenkämpfe, sah junge und elegante Frauen, die an den Haaren weggeschleift wurden,<br />
um in den Treppenhäusern der Wohnblocks verprügelt und vergewaltigt zu werden. Ich sah,<br />
wie Menschen nur deshalb gequält wurden, weil sie Brillen trugen. Auf den Straßen dieser Stadt<br />
habe ich den apokalyptischsten Schrei der Welt gehört: „Tod den Intellektuellen!“ Wie krank muss<br />
eine Gesellschaft sein, damit sie solch einen Agonie-Schrei ausstößt? Ich erinnerte mich an die<br />
Worte des französischen Dichters Lautréamont: „Sämtliche Ozeane der Welt sind nicht in der<br />
Lage, einen Tropfen Blut eines Intellektuellen abzuwaschen.“ Meine Eltern waren auf der Seite der<br />
Neokommunisten und hatten den Bergarbeitern auf den Straßen applaudiert. Wir haben heftig<br />
gestritten und ein Jahr lang nicht mehr miteinander gesprochen. Das kam in vielen rumänischen<br />
Familien vor. Es war die Hölle.<br />
Ein bekannter Dichter, ehemaliger Dissident, sagte in jenen <strong>Jahre</strong>n: „Ich war zu Ceaus¸escus Zeit<br />
glücklicher.“ Die einfachen Leute sagten: „Früher war es besser – du hattest einen sicheren Arbeitsplatz<br />
und es gab keine Inflation.“ Sie hatten vergessen, dass sie vor Hunger beinahe gestorben<br />
wären, erinnerten sich nicht mehr an die Winterkälte, wenn die Heizkörper in den Häusern<br />
einfroren und platzten. Ebenso hatten die von Moses in die Wüste geführten Juden gejammert<br />
und bedauert, die ägyptische Sklaverei verlassen zu haben: „Hast du uns hierher geführt, damit<br />
unsere Gebeine hier in der Wüste bleichen? Wo sind die Fleischtöpfe von ehedem?“<br />
Ich begann ins Ausland zu reisen, war dann jahrelang in Amsterdam, Berlin, Budapest, Wien und<br />
Stuttgart. Als ich Manhattan sah, schrieb ich ein verzweifeltes Gedicht. Ich befand mich oben auf<br />
dem Empire State Building. Ich weinte und schrieb in ein Notizbuch, das ich auf die Balustrade<br />
stützte. Meine Kleider flatterten im Wind wie Fahnen. Wer hatte mir die schönsten <strong>Jahre</strong> meines<br />
Lebens gestohlen? Wer hatte mich sowohl für den Osten als auch für den Westen untauglich gemacht?<br />
Ich war wie die Weisen in T. S. Eliots Gedicht: In Rumänien fand ich meinen Ort nicht,<br />
aber auch im Westen war ich unglücklich. Ich konnte keinen Ausweg erkennen. Der quälende<br />
Übergang (zu was?) würde ewig währen.<br />
Die Rückkehr nach Rumänien war jedes Mal deprimierend: Nun sah ich den physischen und moralischen<br />
Niedergang noch deutlicher. Ich sah die Risse in den unrenovierten Häusern, die Löcher<br />
im Asphalt der Straßen, die Lügen der Politiker und die allgemeine Korruption klarer als früher,<br />
als ich noch keine Vergleichsmöglichkeiten hatte. Jetzt wusste ich, wie ein Mensch zu leben und<br />
wie ein Land zu sein hatte.<br />
Erst nach dem Jahr <strong>20</strong>00 begannen sich die Dinge zum Besseren zu wenden. Die Normalität, für<br />
einige Menschen eine Selbstverständlichkeit, ist für uns ein himmlisches Wunder. Es ist unglaublich,<br />
wie lange wir für ein klein bisschen Normalität hatten kämpfen müssen.<br />
Im vergangenen Jahr kaufte ich mir ein Häuschen im Wald, im Norden der Stadt. Zum ersten Mal<br />
in meinem Leben wohne ich jetzt ebenerdig und nicht in den unterschiedlichen Stockwerken von<br />
Betonblocks. Im Garten pflanzte ich einen Kirschbaum. Es war der erste Baum, den ich jemals in<br />
den Boden eingepflanzt habe. In der Nacht sehe ich nun zum ersten Mal in meinem Leben den<br />
sternenbedeckten Himmel. Und ebenfalls zum ersten Mal habe ich in diesem Jahr gedacht, dass<br />
das wirkliche Leben ab nun beginnen wird, nach 50 <strong>Jahre</strong>n des Unglücks.<br />
Übersetzung: Ernest Wichner<br />
Mircea Cărtărescu, geboren 1956 in Bukarest, ist Dichter, Schriftsteller und Literaturkritiker. Er hat bereits über <strong>20</strong><br />
Bücher verfasst, die bisher in 15 Sprachen übersetzt wurden. Cărtărescu ist außerdem Professor für Literatur an<br />
der Universität von Bukarest und Mitglied der rumänischen Schriftstellervereinigung, des Pen Clubs und der ASPRO<br />
Writers’ Union. Seine Werke wurden mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem wichtigsten<br />
Literaturpreis Rumäniens und dem Acerbi-Preis in Italien. Der <strong>20</strong>07 auf Deutsch erschienene Roman „Die Wissenden“<br />
(Zsolnay Verlag, Wien) bildet den ersten Teil einer Trilogie, die im Original den Titel „Orbitor“ trägt. Cărtărescus<br />
Kurzgeschichtenband „De ce iubim femeile“ wurde <strong>20</strong>05 in Rumänien zum Bestseller. Auf Deutsch erschien dieses<br />
Werk <strong>20</strong>08 unter dem Titel „Warum wir die Frauen lieben“ (Suhrkamp, Frankfurt/Main). Die vorliegende Erzählung<br />
„Die gestohlenen <strong>Jahre</strong>“ verfasste Mircea Cărtărescu eigens für „<strong>Report</strong>“.