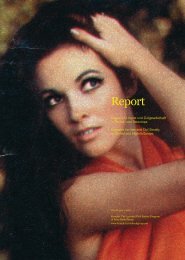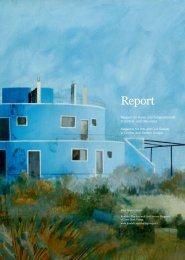Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Report_Issue 1/2009 - Jubiläum/ 20 Jahre Mauerfall
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Manuela Hötzl: Ihr Buch beschreibt im Zuge<br />
der Analyse eines Sprachbegriffs auch die momentane<br />
Befindlichkeit von Europa. Welche<br />
Fragen wirft das Sprachproblem in Europa für<br />
Sie auf?<br />
Boris Buden: Die Hauptfrage in meinem Buch<br />
ist die nach der Zukunft Europas. Eine meiner<br />
Thesen: Es gibt weder eine europäische Sprache<br />
an sich, noch kann eine der europäischen<br />
Nationalsprachen diese Rolle übernehmen.<br />
Aber wie soll Europa, das sich vereinigen will,<br />
in Zukunft kommunizieren? Welche gemeinsame<br />
Sprache – die nötig wäre, wenn Europa<br />
wirklich demokratisch sein will – soll die europäische<br />
Öffentlichkeit sprechen?<br />
Die Sprache Europas kann also nur als eine<br />
Art Übersetzungspraxis begriffen werden,<br />
eine sprachliche Kommunikation, die als Prozess<br />
ständiger wechselseitiger Übersetzungen<br />
erfolgt. Dieser Herausforderung ist man sich<br />
momentan noch gar nicht bewusst. Aber in<br />
Zukunft werden weder die Intellektuellen noch<br />
die Politiker Europas diesem Problem ausweichen<br />
können.<br />
Im Zuge Ihrer Suche nach dem „wahren Ziel<br />
von Übersetzungen“ fahnden Sie auch nach der<br />
„verlorenen gesellschaftlichen Emanzipation“.<br />
Wäre diese der „ideologische Neuanfang von<br />
Europa“, von dem Slavoj Žižek im Klappentext<br />
Ihres Buches spricht?<br />
Die Hauptthese meines Buches ist, dass in unserer<br />
postmodernen Zeit alle Sphären des gesellschaftlichen<br />
Lebens, vor allem aber die politische,<br />
in Kultur, oder wenn Sie so wollen, in<br />
die Sprache der Kultur übersetzt wurden. Kultur<br />
ist heute eine Art ultimativer Übersetzung<br />
geworden. Wir schaffen es nicht mehr, aus dem<br />
alles umfassenden Kulturbegriff hinauszukommen.<br />
Das ist ein Punkt, an dem klar werden<br />
muss, dass von der kulturellen Übersetzung allein<br />
keine globale Emanzipation, wie dies manche<br />
glauben, zu erwarten ist. Der „Neuanfang“,<br />
den Žižek fordert, bedeutet nichts anderes als<br />
eine Re-Politisierung unserer historischen Erfahrung<br />
und der ökonomischen Sphäre. Der<br />
erste Schritt zu diesem neuen Beginn ist die<br />
Erkenntnis, dass es eine Erfahrung auch außerhalb<br />
der Kultur gibt und dass diese Erfahrung<br />
erst durch eine praktische Veränderung zu machen<br />
ist. Früher nannte man diese Veränderung<br />
die Revolution, heute jedoch müssen wir sie<br />
neu erfinden.<br />
Europa ist also auf dem falschen Weg, wenn es<br />
sich über eine gemeinsame kulturelle Identität<br />
definieren möchte?<br />
Natürlich ist Europa auf dem falschen Weg,<br />
wenn es glaubt, die kulturelle Entwicklung allein<br />
könne sein Schicksal entscheiden. Dieser<br />
Glaube ist sogar sehr gefährlich, weil er uns<br />
64<br />
Die<br />
blind für die politischen Widersprüche und<br />
neue, bislang noch unbekannte Antagonismen<br />
macht, die das Projekt der europäischen Einigung<br />
unausweichlich mit sich bringt. Gerade<br />
gegen diese politische Blindheit richtet sich<br />
mein Buch. Genauer gesagt, gegen den naiven<br />
Glauben an eine neue kulturelle Identität.<br />
Und zwar eine Identität, die jenseits der alten<br />
Vorstellung von den essenziellen Identitäten<br />
europäischer Nationen als eine Art „kulturelle<br />
Hybridität“ entstehen soll. Diese würde uns die<br />
Antwort auf eine ebenfalls entscheidende Frage<br />
der europäischen Zukunft ersparen, nämlich<br />
die Frage, ob aus Europa eine Art föderativer<br />
Nationalstaat entstehen soll. Die Souveränität<br />
der existierenden Nationalstaaten muss aber<br />
früher oder später abgeschafft werden oder, im<br />
Gegenteil, Europa muss eine ganz andere Form<br />
der Demokratie ausprobieren.<br />
„Selbst wenn wir Sprachen<br />
nicht perfekt sprechen, sollten<br />
wir sie in den Mund nehmen,<br />
um ihren Geschmack<br />
zu kosten.“<br />
Welche kann das sein?<br />
Das kann etwa eine solche sein, die sich auf die<br />
Tradition der europäischen Revolutionen, oder,<br />
noch präziser, auf die Erfahrungen der revolutionären<br />
Räterepubliken berufen wird.<br />
Die Räterepubliken haben sich doch in dauernden<br />
Streitigkeiten rasch aufgelöst?<br />
In diesem ständigen Streit, aus dem auch mein<br />
Buch heraus entstanden ist, fühle ich mich<br />
nicht so schlecht. Aber Scherz beiseite. Die<br />
Rede ist von einer anderen Demokratieerfahrung,<br />
von einem anderen Konzept der Demokratie.<br />
So wie meine eigene kulturelle Identität,<br />
falls ich eine solche haben sollte, nicht mehr in<br />
den konzeptuellen Rahmen der Nationalkultur<br />
passt. Doch eben diese lässt sich nicht mehr ins<br />
Politische übersetzen und es gibt immer noch<br />
keine Demokratie jenseits des Nationalstaates.<br />
In diesem Raum bin ich sowohl politisch<br />
als auch kulturell ein Nichts, ein Lohnarbeiter,<br />
dessen Rechte weit unter dem Niveau der Arbeiterklasse<br />
vor hundert <strong>Jahre</strong>n liegen, da bin<br />
ich, wie einmal ein kroatischer Nationalist über<br />
eine Nation ohne Staat sagte, „wie Scheiße im<br />
Regen“.<br />
Wie haben Sie persönlich die Veränderungen in<br />
Kroatien erlebt?<br />
Was Kroatien betrifft, träumt dieses Land heute<br />
immer noch seinen kulturellen Souveränitätstraum<br />
und arbeitet damit an einer Selbst-<br />
Der Philosoph Boris Buden, Autor des Buches „Der Schacht von Babel –<br />
Ist Kultur übersetzbar?“, spricht im Interview mit Manuela Hötzl von<br />
einer Gesellschaft, die Politik nicht mit Kultur verwechseln sollte, und<br />
von Europa als einer Übersetzungsgemeinschaft.<br />
— Manuela Hötzl im Gespräch mit Boris Buden —<br />
evolution<br />
neu erfinden<br />
Isolation seiner Kultur. Obwohl die Kroaten<br />
ihre Sprache mit Serben und Bosniern teilen,<br />
versuchen sie, ihre eigene Version von den zwei<br />
anderen radikal abzugrenzen. Auf diese Weise<br />
schaden sie unendlich ihrer eigenen Sprache.<br />
Die Folge dieses Sprachautismus ist eine Situation,<br />
die an jene aus dem 19. Jahrhundert<br />
erinnert, als sich Kroatien noch innerhalb<br />
der Habsburger Monarchie befand. Die Elite<br />
studierte damals hauptsächlich in Wien und<br />
sprach Deutsch, die Sprache des Wissens, intellektueller<br />
Kommunikation und Hochkultur.<br />
Den Volksmassen blieb die vollkommen autistische,<br />
zu einer ernsthaften kulturellen und<br />
intellektuellen Produktion gar nicht fähige kroatische<br />
Muttersprache.<br />
Wurde Deutsch durch eine neue „Elitensprache“<br />
ersetzt?<br />
Heute ist Englisch die Sprache der Elite. Diese<br />
Elite studiert im Ausland, hauptsächlich an den<br />
amerikanischen oder britischen Fakultäten, wo<br />
die intellektuelle Kommunikation sich vor allem<br />
in englischer Sprache abspielt.<br />
Kann Englisch nicht die Rolle einer gemeinsamen<br />
europäischen Sprache übernehmen?<br />
Der französische Philosoph Etienne Balibar<br />
hat darauf aufmerksam gemacht, dass Englisch<br />
„mehr oder weniger“ die europäische Sprache<br />
ist. Aber Englisch ist auch die Sprache der<br />
globalen Kommunikation, die in vielen unterschiedlichen<br />
Formen auftritt. Andererseits ist<br />
Englisch auch die Sprache nur zweier der europäischen<br />
Nationen. Warum sollte also ausgerechnet<br />
diese Sprache die Rolle der Sprache<br />
Europas übernehmen?<br />
Sie gehen vom Sprachbegriff Wilhelm von<br />
Humboldts aus, der eine Nation letztlich nur<br />
über die Sprache definierte. Haben sich gerade<br />
die osteuropäischen Staaten dieses Konzept zu<br />
einfach angeeignet?<br />
Auf dem humboldtschen Verständnis von Sprache<br />
als einer in sich geschlossenen Totalität<br />
und als Ausdruck einer in sich geschlossenen<br />
Gemeinschaft beruht auch die Idee einer Homologie<br />
von Sprache und Kultur, die in letzter<br />
Konsequenz impliziert, dass es keine europäische<br />
Kultur an sich geben kann bzw. dass die<br />
europäische Kultur nur eine Art Summe europäischer<br />
Nationalkulturen ist. Auch die osteuropäischen<br />
Nationen hatten die romantische<br />
Phase der Nationenbildung, und zwar meistens<br />
im 19. Jahrhundert. Das ist auch dann passiert,<br />
wenn es ihnen nicht gleich gelungen ist, diese<br />
kulturelle „Wiedererstehung“ mit der Gründung<br />
eines eigenen Nationalstaates zu krönen.<br />
Wenn sie heute diesen Prozess politisch<br />
zu Ende bringen, erscheint er uns als eine Art<br />
Anachronismus.<br />
Passiert das Gleiche auch im Westen?<br />
Man denke nur an all die Institutionen der sogenannten<br />
Nationalkultur, die sich sowohl im<br />
Osten als auch im Westen weiterhin politischer<br />
Unterstützung erfreuen und das kulturelle Leben<br />
in ganz Europa dominieren. Institutionell<br />
sind damit die europäische Kultur und die auf<br />
Nationalsprachen basierenden Erziehungssysteme<br />
europäischer Völker noch immer auf dem<br />
Stand des 19. Jahrhunderts.<br />
Immer mehr Staaten, auch Österreich, zwingen<br />
Ausländer, die Landessprache zu erlernen.<br />
Halten Sie das für richtig?<br />
Dieser Zwang ist kontraproduktiv. Außerdem<br />
ist er ebenso von einer konservativen historischen<br />
Perspektive motiviert, nämlich von der<br />
Überzeugung, die Nationalkultur bilde den ultimativen<br />
Horizont moderner Kultur, und wer<br />
sie nicht hat, sei akulturell oder primitiv. Der<br />
schon genannte Etienne Balibar sah gerade die<br />
Zukunft europäischer Kultur in Menschen, die<br />
den Horizont der Nationalkultur überschritten<br />
haben.<br />
Welche Übersetzungsmethoden sollen demnach<br />
in der EU praktiziert werden?<br />
Das kann ich nicht beantworten. Etwas jedoch<br />
muss betont werden: dass Übersetzung immer<br />
mehr ist als bloß ein sprachliches Geschehen. Es<br />
ist immer auch eine kulturelle, politische und<br />
soziale Auseinandersetzung mit dem Fremden.<br />
Die sogenannte sprachliche oder literarische<br />
Übersetzung ist nur ein Teil der „Übersetzungspraxis“,<br />
wie ich sie verstehe.<br />
Sollten wir alle in Zukunft mehr Sprachen sprechen?<br />
Ja, selbst wenn wir sie nicht perfekt sprechen<br />
und verstehen, sollten wir sie in den Mund nehmen,<br />
um ihren Geschmack zu kosten.<br />
Boris Buden, geboren 1958 in Kroatien, studierte klassische<br />
und moderne Philosophie in Klagenfurt, Zagreb<br />
und Ljubljana. Seit 1984 arbeitet er als freier Journalist<br />
und Publizist. Buden veröffentlicht regelmäßig auf<br />
Deutsch, Englisch und Französisch philosophische, politische<br />
und kulturkritische Essays. Als Aktivist der kroatischen<br />
Friedensbewegung rief er 1993 die Zeitschrift<br />
„arkzin“ ins Leben.<br />
Boris Buden, „Der Schacht von Babel – Ist Kultur übersetzbar?“,<br />
Kulturverlag Kadmos, Berlin <strong>20</strong>04<br />
Boris Buden/Stefan Nowotny, „Übersetzung: das Versprechen<br />
eines Begriffs“, Turia + Kant, Wien <strong>20</strong>08<br />
Das gesamte Interview mit Boris Buden ist im „<strong>Report</strong>“<br />
1/<strong>20</strong>05 erschienen.