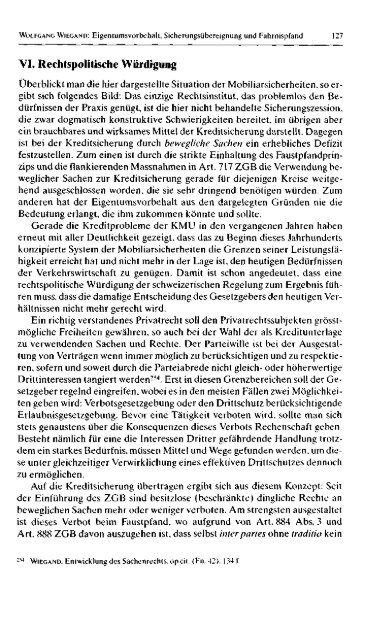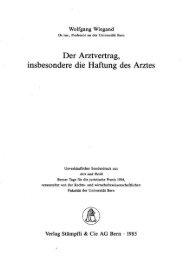Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Fahrnispfand
Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Fahrnispfand
Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Fahrnispfand
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WOLFGANG WIEGAND: <strong>Eigentumsvorbehalt</strong>, <strong>Sicherungsübereignung</strong> <strong>und</strong> <strong>Fahrnispfand</strong> 127<br />
VI. Rechtspolitische Würdigung<br />
Überblickt man die hier dargestellte Situation der Mobiliarsicherheiten, so ergibt<br />
sich folgendes Bild: Das einzige Rechtsinstitut, das problemlos den Bedürfnissen<br />
der Praxis genügt, ist die hier nicht behandelte Sicherungszession,<br />
die zwar dogmatisch konstruktive Schwierigkeiten bereitet, im übrigen aber<br />
ein brauchbares <strong>und</strong> wirksames Mittel der Kreditsicherung darstellt. Dagegen<br />
ist bei der Kreditsicherung durch bewegliche Sachen ein erhebliches Defizit<br />
festzustellen. Zum einen ist durch die strikte Einhaltung des Faustpfandprinzips<br />
<strong>und</strong> die flankierenden Massnahmen in Art. 717 ZGB die Verwendung beweglicher<br />
Sachen zur Kreditsicherung gerade für diejenigen Kreise weitgehend<br />
ausgeschlossen worden, die sie sehr dringend benötigen würden. Zum<br />
anderen hat der <strong>Eigentumsvorbehalt</strong> aus den dargelegten Gründen nie die<br />
Bedeutung erlangt, die ihm zukommen könnte <strong>und</strong> sollte.<br />
Gerade die Kreditprobleme der KMU in den vergangenen Jahren haben<br />
erneut mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass das zu Beginn dieses Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
konzipierte System der Mobiliarsicherheiten die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit<br />
erreicht hat <strong>und</strong> nicht mehr in der Lage ist, den heutigen Bedürfnissen<br />
der Verkehrswirtschaft zu genügen. Damit ist schon angedeutet, dass eine<br />
rechtspolitische Würdigung der schweizerischen Regelung zum Ergebnis führen<br />
muss, dass die damalige Entscheidung des Gesetzgebers den heutigen Verhältnissen<br />
nicht mehr gerecht wird.<br />
Ein richtig verstandenes Privatrecht soll den Privatrechtssubjekten grösstmögliche<br />
Freiheiten gewähren, so auch bei der Wahl der als Kreditunterlage<br />
zu verwendenden Sachen <strong>und</strong> Rechte. Der Parteiwille ist bei der Ausgestaltung<br />
von Verträgen wenn immer möglich zu berücksichtigen <strong>und</strong> zu respektieren,<br />
sofern <strong>und</strong> soweit durch die Parteiabrede nicht gleich- oder höherwertige<br />
Drittinteressen tangiert werden 254 . Erst in diesen Grenzbereichen soll der Gesetzgeber<br />
regelnd eingreifen, wobei es in den meisten Fällen zwei Möglichkeiten<br />
geben wird: Verbotsgesetzgebung oder den Drittschutz berücksichtigende<br />
Erlaubnisgesetzgebung. Bevor eine Tätigkeit verboten wird, sollte man sich<br />
stets genaustens über die Konsequenzen dieses Verbots Rechenschaft geben.<br />
Besteht nämlich für eine die Interessen Dritter gefährdende Handlung trotzdem<br />
ein starkes Bedürfnis, müssen Mittel <strong>und</strong> Wege gef<strong>und</strong>en werden, um diese<br />
unter gleichzeitiger Verwirklichung eines effektiven Drittschutzes dennoch<br />
zu ermöglichen.<br />
Auf die Kreditsicherung übertragen ergibt sich aus diesem Konzept: Seit<br />
der Einführung des ZGB sind besitzlose (beschränkte) dingliche Rechte an<br />
beweglichen Sachen mehr oder weniger verboten. Am strengsten ausgestaltet<br />
ist dieses Verbot beim Faustpfand, wo aufgr<strong>und</strong> von Art. 884 Abs. 3 <strong>und</strong><br />
Art. 888 ZGB davon auszugehen ist. dass selbst interpartes ohne traditio kein<br />
WIEGAND. Entwicklung des Sachenrechts, op.cit. (Fn. 42), 134 f.