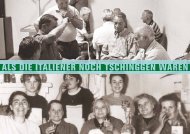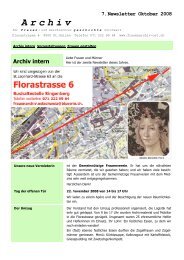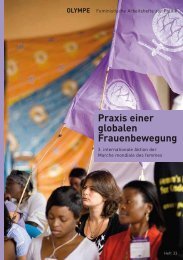Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
lesben im Sport – Zwischen unsichtbarkeit und Skandal<br />
Myrjam Cabernard<br />
Rund fünf bis zehn Prozent der Frauen empfinden gleichgeschlechtlich. Zumindest<br />
einige davon dürften auch Spitzensport betreiben. Doch wo sind sie, die lesbischen<br />
Skifahrerinnen, Fussballerinnen oder Leichtathletinnen? 1 «Hm ... keine<br />
110 Ahnung. Und überhaupt: Es spielt doch keine Rolle, ob eine Sportlerin lesbisch<br />
Disziplin; die Fussballerinnen mussten sich gar bis 1996 gedulden. 111<br />
10 <strong>Sportlerinnen</strong> in<br />
ist oder hetero, das ist Privatsache und hat mit der sportlichen Leistung nichts zu<br />
tun.» 2 Das ist richtig, nur: Wie viele heterosexuelle <strong>Sportlerinnen</strong> gibt es? Weshalb<br />
darf der Freund oder Ehemann offiziell und stolz am Spielfeld stehen? Und<br />
wie kommt es, dass die Lebenspartnerin einer lesbischen Sportlerin unsichtbar<br />
bleibt?<br />
Von «männlicher Stärke» und «weiblicher Schwäche»<br />
Die traditionellen Geschlechterrollen beruhen auf dem komplementären Schema<br />
der «männlichen Stärke» und der «weiblichen Schwäche» 3 : Begriffe wie Kraft, Stärke<br />
oder Durchsetzungsvermögen gelten als männlich, Eigenschaften wie Schwäche,<br />
Schönheit oder Anschmiegsamkeit als weiblich. Parallel zur Industriegesellschaft<br />
entwickelte sich im 19. Jahrhundert der moderne Sport als Domäne von Männern<br />
für Männer. 4 Der Sport wurde damit zum Inbegriff der Werte, die als männlich<br />
galten und Weiblichkeit ausschlossen. 5 Es erstaunt daher nicht, wenn Frauen und<br />
pubertierende Mädchen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit medizinischen<br />
und moralischen Argumenten von als männlich geltenden sportlichen Betätigungen<br />
wie Rennen, Springen oder Kämpfen abgehalten wurden: «Die weiblichen Unterleibsorgane<br />
verwelken und das künstlich gezüchtete Mannsweib ist fertig.» 6 Zu viel<br />
Aktivität mit männlichem Charakter bewirke, dass der weibliche Körper sich dem<br />
eines Mannes angleiche. Als Folge mangelnder Körperbetätigung und einschnüren-<br />
Olympe 21/05<br />
der Kleider zeigten viele Mädchen denn auch bald tatsächliche Anzeichen von konstitutioneller<br />
Schwäche. 7<br />
Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch die «weibliche Conträrsexuelle» erfunden:<br />
Weibliche Homosexualität galt fortan als pathologischer Zustand, bei dem «das<br />
Weib sich als Mann fühlt». 8 Die «originär-lesbische» Frau galt als Karikatur des<br />
Mannes, mit derbem Auftreten, selbstbewusstem Gang und unweiblichem Körper,<br />
triebgesteuert, unersättlich und «ansteckend». Frauenliebende Frauen, die nicht ins<br />
Bild des Mannsweibs passten, bezeichnete die Wissenschaft kurzerhand als «pseudo-homosexuell».<br />
9 Grundsätzlich konnte jede Frau und jedes Mädchen von einem<br />
«originär-lesbischen» Mannsweib verführt oder «angesteckt» werden. Darum die<br />
Warnung an alle Frauen: Meidet Lesben und männliche Sportarten. Zudem zementierte<br />
sich in vielen Köpfen die Vorstellung, dass eine Frau mit Vorlieben für Männersportarten<br />
auch lesbisch sein müsse.<br />
Zerrissenheit zwischen Sportlerin und frau<br />
Das ist lange her. Ableger dieses Gedankenguts nisten freilich immer noch in den<br />
Köpfen. Zwar haben sich Frauen in den vergangenen hundert Jahren einen Platz im<br />
Sport erkämpft – gegen alle Widerstände: Frauenhandball ist seit 1976 olympische<br />
Männersportarten wurden mit dümmlichen Kommentaren eingedeckt und lächerlich<br />
gemacht. 11 Die Medien bezeichneten sie als geschlechtsabnorm und unweiblich,<br />
wenn der Körper muskulös und die Bewegungen nicht weiblich anmutig, sondern<br />
bestimmt und raumgreifend waren. Und immer droht(e) der Verdacht, eine Lesbe<br />
zu sein. Die Tennisspielerin Martina Navratilova galt in den 1980er Jahren als unweibliches<br />
Muskelpaket. Die Medien betitelten sie als «grobschlächtiges Raubtier»,<br />
bei der eine «Chromosomenschraube locker sein müsse» und die «von Natur aus<br />
etwas anderes sei als eine Frau». 12 Allerdings hat sich das Idealbild des «weiblichen<br />
Körpers» in den letzten Jahren stark verändert: Muskeln sind heute – zumindest in<br />
einem gewissen Rahmen – durchaus trendy und gelten auch als sexy. Martina Navratilova<br />
hielt unlängst neidlos fest: «Gegen die Williams-Schwestern 13 sehe ich aus<br />
wie ein Schluck Wasser in der Kurve.» 14<br />
Trotzdem gilt auch heute: Während Männer als Sportler in ihrer Geschlechtsidentität<br />
bestärkt werden, kann sich eine Sportlerin nicht als Frau fühlen, weil<br />
sie sportliche Höchstleistungen erbringt, sondern höchstens, obwohl sie dies<br />
tut. 15 Eine Sportlerin lebt in zwei getrennten Welten: In der Welt des Sports,<br />
wo sie «männliche» Eigenschaften haben muss, und in der Welt ausserhalb, wo<br />
sie «weiblich» sein muss, um als Frau anerkannt zu werden. 16 Das kann zu einer<br />
Zerrissenheit zwischen Sportlerin-Sein und Frau-Sein führen. 17 Strategien<br />
daraus sind der totale Rückzug aus dem Sport oder der Rückzug in den Sport: