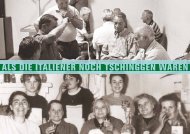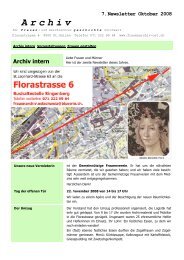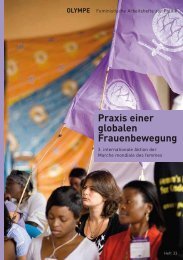Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zu dieser Ausgabe<br />
«Höher zu klettern als ein Kamerad, einen anderen unterzukriegen<br />
heisst: seine Überlegenheit über die ganze Welt zu bestätigen. Ein derartiges<br />
Draufgängertum ist dem Mädchen verwehrt. Kein Vertrauen<br />
mehr zu seinem Körper haben heisst, sein Selbstvertrauen verlieren.<br />
(…) Lasst die Frau nur schwimmen, Klettertouren machen, ein Flugzeug<br />
steuern, gegen die Elemente ankämpfen, Gefahren und Abenteuer<br />
bestehen, und sie wird <strong>vor</strong> der Welt die Furchtsamkeit, von der ich<br />
eben sprach, nicht empfinden.»<br />
Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht<br />
Die Olympe nimmt das UNO-Jahr des Sports und der Sporterziehung zum Anlass,<br />
einen kritischen Blick auf den Sport und die Sportberichterstattung zu werfen. Sport<br />
hat stark normativen Charakter und ist eine zentrale Instanz, was die Ausbildung<br />
der Geschlechtsidentität und die Reproduktion der Geschlechterordnung anbelangt.<br />
4 Im Sport sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern immer noch beträchtnikova<br />
ist der bestverdienende weibliche Tennisstar, obwohl sie keinen einzigen 5<br />
lich, überholte Rollenklischees halten sich hartnäckig. Dabei ist der Sport nicht<br />
nur Spiegel der Gesellschaft, sondern auch ein Ort, wo Geschlechter stereotypen<br />
gebildet und zementiert werden. Der Sport bildet das Verhältnis der Geschlechter<br />
nicht nur ab, sondern rechtfertigt es auch. Soziale Unterschiede werden auf biologische<br />
zurückgeführt, wie etwa die körperliche Überlegenheit des männlichen starken<br />
Geschlechts über das weibliche schwache. Heute, wo sich die Trainingsbedingungen<br />
der Frauen denjenigen der Männer angepasst haben, haben sich die Leistungsunterschiede<br />
zwischen den Geschlechtern signifikant verringert.<br />
Die Geschichte des Frauensports ist bewegt – von seinen Anfängen bis heute. Seit<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts kämpfen Frauen um das Recht auf sportliche Betätigung.<br />
Sport war und ist ein «grosser Trainingsplatz für die Aufholjagd der Frauen<br />
in ihrem Streben nach Gleichberechtigung» 1 . Wie sehr die Geschichte des Frauensports<br />
mit der Frauenemanzipation verknüpft ist, illustriert das folgende Beispiel:<br />
Ein Jahr nachdem in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, wurde<br />
auch das Mädchenturnen dem Bubenturnen gleichgestellt. Wenn Frauen Sport treiben<br />
wollten, konnten sie dies lange Zeit nur innerhalb des eng gesteckten Rahmens<br />
der Gesundheits<strong>vor</strong>sorge, nicht zuletzt im Hinblick auf eine künftige Mutterschaft,<br />
tun. Vom Wettkampf blieben sie weit bis ins 20. Jahrhundert ausgeschlossen. Doch<br />
inzwischen haben die Frauen rasant aufgeholt: Frauen und Männer treiben mittlerweile<br />
mit der selben Häufigkeit Sport. An der letzten Olympiade betrug der An-<br />
Olympe 21/05<br />
teil der <strong>Sportlerinnen</strong> über 40%. Die starke Zunahme von Frauen im Breiten- und<br />
Spitzensport in den letzten fünfzig Jahren wird als «die grösste Veränderung im<br />
Sportsystem» bezeichnet 2 .<br />
Doch obwohl Frauen sowohl als Akteurinnen als auch als Konsumentinnen beinahe<br />
alle Sportarten erobert haben und der Frauenanteil in Sportvereinen inzwischen<br />
über 40% beträgt, sind die Entscheidungsgremien im ehrenamtlichen wie im professionellen<br />
Bereich immer noch fest in Männerhand. Auf der Ebene von Trainern<br />
und Sportfunktionären sind Frauen nach wie <strong>vor</strong> sehr schlecht vertreten. Die Sportbeilagen<br />
der Tageszeitungen zeichnen ein ähnlich tristes Bild, was den Frauensport<br />
anbelangt. <strong>Sportlerinnen</strong> kommen in der Sportberichterstattung kaum <strong>vor</strong>. Medienauswertungen<br />
belegen, dass nur gerade knapp ein Zehntel aller Beiträge Frauensport<br />
thematisieren. Die traditionellen Männersportarten wie Fussball, Eishockey,<br />
Rad- und Motorsport stehen im Rampenlicht der nationalen und internationalen<br />
Sportberichterstattung, über Frauensportarten wird nur am Rand berichtet. In der<br />
Regionalsportberichterstattung sieht das Bild ähnlich aus.<br />
Wenn <strong>Sportlerinnen</strong> Eingang in die Medien finden, dann zudem meist nicht wegen<br />
ihrer sportlichen Leistungen. Spielerinnen wie Anna Kournikova zeigen, dass bei<br />
<strong>Sportlerinnen</strong> das Aussehen höher gewertet wird als der sportliche Erfolg. Kour-<br />
Turniersieg <strong>vor</strong>weisen kann. Neben den Medien und der Wirtschaft machen auch<br />
die Sportverbände Druck auf die <strong>Sportlerinnen</strong>, sich möglichst attraktiv zu präsentieren.<br />
Von einer echten Gleichstellung im Sport sind wir noch weit entfernt. Dies zeigt<br />
sich nicht zuletzt daran, wie schwer es auch heute noch für Frauen ist, in lukrative<br />
und prestigeträchtige Männersportarten einzudringen. Doch die Aufholjagd der<br />
Frauen geht weiter. Immer mehr Mädchen und Frauen dringen in eine der letzten<br />
Männersportbastionen ein: den Fussball. Erst kürzlich hat Fifa-Chef Sepp Blatter<br />
die Zukunft des Fussballs als weiblich bezeichnet. Im April dieses Jahres fand unter<br />
eben diesem Motto in Deutschland der erste Frauen- und Mädchen-Fussballkongress<br />
statt. Damit <strong>Sportlerinnen</strong> nicht nur in Bezug auf Teilnahme, sondern auch in<br />
Bezug auf gesellschaftliche Anerkennung, mediale Präsenz und öffentliche Gelder<br />
mit ihren Kollegen gleichziehen können, ist eine kritische Auseinandersetzung mit<br />
dem Sportgeschehen unabdingbar.<br />
Martina Buzzi, Sandra Meier, Anna Sax, Susi Wiederkehr<br />
1 Jutta Deiss, Frauen in Bewegung, http://www.frauen-aktiv.de/aktiv/9/seite3.php<br />
2 Markus Lamprecht, Hanspeter Stamm, Sport zwischen Kultur, Kult und Kommerz, Zürich 2002, S. 96.