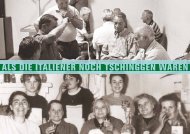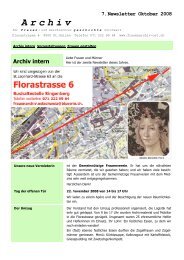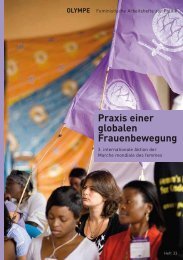Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
98<br />
Gute weibliche «Quoten» bringt auch die theoretische Auseinandersetzung mit den<br />
soziologischen und philosophischen Ebenen des Sports bzw. des Sportbusiness (sofern<br />
diese in den Medien überhaupt stattfindet). Also Artikel, die sich mit der hypnotischen<br />
Dramaturgie von Radrennen, mit der kulturellen Tradition des «athletischen Körpers»,<br />
mit der Frage, inwieweit Sport ein Ersatz für Krieg ist oder warum die Freestyle-Freizeitsportler-Generation<br />
ein unsicheres Publikum für traditionelle Mediensportarten ist,<br />
beschäftigen. Alles Themen, die den herkömmlichen Leser von Sportseiten – nämlich<br />
den klassischen Fussball- oder Hockey-Fan – nicht besonders interessieren. Dafür sind<br />
sie spannend für jene, die nicht so nahe an einer einzelnen Sportart dran sind, im täglichen<br />
Umfeld aber ständig damit in Berührung kommen. Das trifft auf viele Frauen zu,<br />
die häufig über die Männer in ihrem Leben (Väter, Brüder, Ehemänner und <strong>vor</strong> allem<br />
Söhne) mit den positiven und negativen Auswirkungen von populären Freizeit- und<br />
Medien-Sportarten konfrontiert sind.<br />
Allerdings sind auch diese theoretischen Auseinandersetzungen meist von männerzentristischem,<br />
ja fast zirkulärem Denken geprägt. Das heisst, die männlichen Autoren gehen<br />
bei ihrer Phänomenologie des Sports von einer symbolischen Welt<strong>vor</strong>stellung aus,<br />
in der das Weibliche nicht <strong>vor</strong>kommt. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil ebendieses<br />
Weibliche auch in den historischen Vergleichskategorien nicht präsent ist (im Sport<br />
geht es bekanntlich um Kraft, Ausdauer, um übermenschliche Anstrengung bis zum<br />
Zusammenbruch, um selbstgewählte, öffentlich zur Schau gestellte Leidensfähigkeit,<br />
um Kampf, Sieg und Heldentum). Und doch stecken in diesen «Männerthemen» viele<br />
spannende Ansätze für eine Auseinandersetzung mit dem Frauensport, der sich auch<br />
gut journalistisch aufbereiten liesse: Zum Beispiel die Tatsache, dass Spitzensportlerinnen<br />
in der Regel von männlichen Trainern betreut werden, was häufig eine klassische<br />
Geschlechterbeziehung zur Folge hat, die jener von Lehrer und Schülerin ähnelt. Dieses<br />
Thema kommt in den Medien höchstens mal in einem Nebensatz <strong>vor</strong>.<br />
Obwohl der Sportjournalismus in den letzten Jahren immer stärker von medizinischen<br />
Details geprägt wird (Doping, Verletzungen, Trainingsaufbau), ist es ein absolutes Tabu,<br />
darauf hinzuweisen, dass die Sportmedizin nach wie <strong>vor</strong> in ihrer Mehrheit auf den<br />
männlichen Körper fixiert bleibt. Der Körper einer Sportlerin muss also so weit wie<br />
möglich den physiologischen Voraussetzungen eines Männerkörpers angepasst werden,<br />
damit die für Letzteren entwickelte Trainingslehre auch auf den weiblichen Körper angewandt<br />
werden kann. Zum Beispiel hat im Leben einer Spitzensportlerin ein natürlicher<br />
Menstruationszyklus nichts zu suchen. Das hormonelle Auf und Ab des Monatszyklus<br />
passt nicht in einen Leistungsaufbau, wie er am männlichen Körper entwickelt<br />
wurde. In diesem Zusammenhang findet höchstens die Tatsache, dass viele jugendliche,<br />
in der Entwicklung befindliche Frauenkörper dieser am Männerkörper entwickelten<br />
Leistungsanforderung nicht standhalten, hin und wieder Erwähnung – wenn es um Risiken<br />
für junge Spitzensportlerinnen geht (um die sogenannte Female Athlete Triad,<br />
99<br />
Olympe 21/05