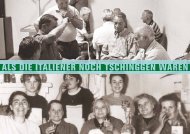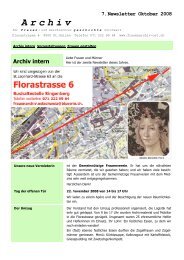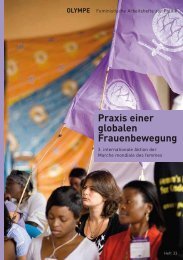Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Weiblichkeit und fussball<br />
Anlässlich der Fifa-Weltmeisterschaften im Herrenfussball begeistern sich alle<br />
vier Jahre unzählige Fans jeder Altersstufe für das Sammeln der «Panini»-Kleber<br />
mit den Spielerporträts. Wieso funktioniert diese kommerzielle Erfolgsgeschichte<br />
in Europa (und somit der Schweiz) denn nicht auch im Frauenfussball? Ganz<br />
im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen entsprechen Fussballerinnen dem<br />
gesellschaftlich verankerten geschlechtsspezifischen Idealtypus nicht. Diese Feststellung<br />
hängt natürlich weniger mit der anatomischen Wirklichkeit zusammen<br />
als mit der als unvereinbar empfundenen Verknüpfung von Weiblichkeit und<br />
Fussball in unserer Alltagswelt.<br />
1970 äusserte der deutsche Torjäger Gerd Müller: «Wenn meine Frau Fussball<br />
spielen wollte, würde ich sie in den Allerwertesten treten.» Der «Bund» kommentierte<br />
diese «kernig-bayrische» Aussage nicht weiter. 4 Zwanzig Jahre später<br />
äusserte sich auch Otto Rehagel, der neue Gott am griechischen Fussballhimmel,<br />
zum selben Thema: «Frauen sind grazile Wesen. Kunstturnerinnen<br />
finde ich schön. Aber Mädchen, die wie Brauereipferde auf Fussballfeldern<br />
rumstapfen – da hört doch alles auf!» 5 Die gesellschaftlichen Schönheitsideale<br />
eines Männer- oder Frauenkörpers beeinflussen die Geschlechtsidenti-<br />
74 tät massgeblich: «Female muscularity is viewed as distasteful and inhumane.<br />
de auch die Integration «von Männern und Männlichkeit» in die Diskussion über die 75<br />
Masculine strength and bravura are celebrated and viewed as heroic.» 6 Noch<br />
heute besteht in unserer Gesellschaft ein latenter Konflikt zwischen dem Frau-<br />
Sein und dem Sportlerin-Sein. Weiblichkeitsattribute werden auch noch im<br />
21. Jahrhundert über Schlagworte wie Zurückhaltung, Passivität, Schwäche<br />
und Schüchternheit definiert, während eine Sportlerin kämpferisches, aktives,<br />
ehrgeiziges und selbstbewusstes Engagement an den Tag legen muss, um erfolgreich<br />
zu sein.<br />
Merk-Rudolph relativiert unsere als natürlich empfundene Alltagswirklichkeit:<br />
«Die Definition dessen, was in unserer Zivilisation als weiblich bzw. männlich<br />
gilt, war früher anders als heute und wird sich morgen wieder ändern.» 7 Neben<br />
diesem zeitlichen Aspekt hob Harris aber auch die geographische Relevanz her<strong>vor</strong>,<br />
da «der Begriff von Maskulinität-Feminität durch die jeweiligen Kulturen<br />
und Gesellschaften, in denen man lebt, bestimmt wird, (...).» 8 An dieser Stelle<br />
sei nochmals auf die Stellung des women’s soccer in der nordamerikanischen<br />
Gesellschaft hingewiesen. Gleichzeitig muss diese idyllisch anmutende permissive<br />
Haltung aber relativiert werden, denn exklusiv männliche Sportdomänen<br />
existieren in den USA sehr wohl. Diese siedeln sich bei den als «uramerikanisch»<br />
empfundenen und somit patriotisch angehauchten Sportarten wie American<br />
Football, Baseball und Basketball an. In einigen Staaten nimmt auch Eishockey<br />
diesen Stellenwert ein.<br />
Olympe 21/05<br />
Ganzheitlicher Gender-Diskurs<br />
Während die deutsche Sprache zwischen dem biologisch-anatomischen Geschlecht<br />
und der Geschlechtsidentität keinen Unterschied macht, differenziert das Englische<br />
zwischen «sex» und «gender». Durch diese Distinktion versuchten amerikanische<br />
Frauenforscherinnen die traditionell biologistischen Denkmuster aufzuweichen<br />
und den argumentativen Spielraum mittels eines Begriffs zu erweitern, der die geschlechtsspezifische<br />
Rollenzuschreibung symbolisierte. Dank dieser Definition wur-<br />
Geschlechterverhältnisse gefördert. 9<br />
Dribbeln, Flanken schlagen, jonglieren oder Kopftore erzielen sind keineswegs<br />
geschlechtsbedingte motorische Abläufe, sondern können durch Training geübt<br />
und durch die Aneignung koordinativer Fähigkeiten perfektioniert werden.<br />
Knaben werden nicht als Fussballspieler geboren, sondern in unseren Breitengraden<br />
durch ständige Stimulationen, regelmässige Spielgelegenheiten, Erwartungsdruck<br />
und Anfeuerungen der Erwachsenen oder Kameraden usw. dazu<br />
erzogen.<br />
Die Einbindung der maskulinen Realität und der somit ganzheitliche Gender-Diskurs<br />
gesteht Buben und Männern das Recht zu, auch dann als «richtige Kerle» zu<br />
gelten, wenn sie nicht Fussball spielen können oder (oder noch schlimmer und …)<br />
sich nicht für diesen Ballsport interessieren. Somit geraten also auch Knaben, die<br />
den gängigen Vorstellungen nicht entsprechen und sich vielleicht, wie im Kinofilm<br />
«Billy Elliot», lieber im Ballettsaal als im Boxring bewegen, unter gesellschaftlichen<br />
Druck. Der Einbruch von Fussballerinnen oder Eishockeyspielerinnen in<br />
vermeintlich sichere Männerdomänen und die sich damit allmählich aufweichenden<br />
Gesellschaftsnormen verhelfen demzufolge auch jenen Männern und Knaben<br />
zu mehr Akzeptanz und Freiraum, welche eine als «unmännlich» konnotierte<br />
Sportart ausüben. Der ganzheitliche Gender-Diskurs greift natürlich auch bei Automechanikerinnen<br />
und Säuglingspflegern jenseits der sportlichen Thematik. Wer