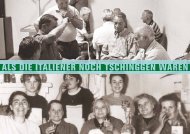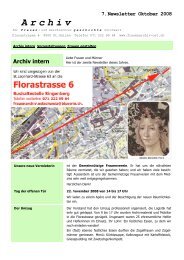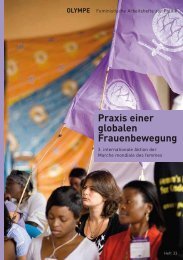Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Stefan Banz’ «The Muhammad Ali’s», 1999/2000 (Abb. 4–7). Für die letztgenannte<br />
Arbeit bat der Künstler Unbekannte, Freunde oder Künstlerkollegen darum,<br />
sich in die Person Muhammad Alis hineinzuversetzen und eine entsprechende<br />
Pose einzunehmen.<br />
Banz, der sich zu seiner früh gewachsenen Begeisterung für das grosse Boxidol<br />
bekennt, nimmt einen Sportler zum Ausgangspunkt seiner Arbeit, der weltweit in<br />
sämtlichen Gesellschafts- und Altersschichten so bekannt sein dürfte wie kaum ein<br />
anderer. Der Schweizer Künstler entwickelt aber viel mehr als nur eine Arbeit über<br />
die Rezeption eines Sportidols. Er zeigt ein sehr sensibles Gespür für die Fotografierten,<br />
sie stehen im eigentlichen Zentrum der einhundertteiligen Serie. Banz<br />
lichtete weibliche und männliche Gegenüber jeden Alters ab und erreicht damit ein<br />
sehr breites Spektrum der selbstdarstellerischen Möglichkeiten von angriffslustigen,<br />
drohenden über defensive oder zurückhaltende Typen bis hin zu bereits Geschlagenen.<br />
Eine jede Aufnahme gibt damit nicht nur Auskunft über das Bild des Einzelnen<br />
von Muhammad Ali, sondern auch über die Charaktere und Lebenshaltungen<br />
der Porträtierten selbst.<br />
Der Japaner Daisuke Nakayama entzieht dem Boxsport alles, was ausser den Ath-<br />
Abb. 4<br />
leten wie selbstverständlich dazugehört: die Arena, den Schiedsrichter, die Halle,<br />
Abb. 5<br />
32 die Zuschauermenge. Auf einer weissen Fläche sind die Boxer selbst nur noch schemenhaft<br />
zu sehen. Dadurch geht genau das verloren, was den Sport ausmacht: die<br />
Körperlichkeit der Kämpfer, ihr Schweiss, das Blut, das Aufeinandertreffen fleischlicher<br />
Massen, die Atmosphäre des Rings. Von «Full Contact» also keine Spur, statt<br />
dessen «White Distance». Der Titel dieser Serie deutet es an, mit diesem Verfahren<br />
wird der Boxsport seinem emotionsgetränkten Umfeld enthoben und in eine Sphäre<br />
der Reinheit und beinahe schon der Vergeistigung gesetzt, etwas, was diesem Sport<br />
jedoch kaum gerecht wird. Ganz anders die Arbeiten zweier Künstlerinnen: Die<br />
Deutsche Tamara Grcic lässt den Betrachter in ihrer dreiteiligen Videoinstallation<br />
33<br />
«Boxer», 1998, auf die nackten Rücken dreier Kämpfer blicken. Durch die Überlebensgrösse<br />
der projizierten Leiber, durch das Stöhnen und die hörbaren Schläge der<br />
Männer sowie die Schweissperlen auf ihren Rücken spricht die Arbeit den Betrachter<br />
sehr direkt an, nur schwer ist es möglich, sich dieser Intensität zu entziehen. Hier<br />
wird der Boxsport in seiner physischen Dimension den Möglichkeiten des Mediums<br />
entsprechend greifbar, was beim Betrachter nicht unbedingt nur angenehme Emotionen<br />
evoziert.<br />
Ähnlich intensiv wirkt der Film «Boxing», 1998, der Norwegerin Vibeke Tandberg.<br />
Die Künstlerin tritt hierin gegen sich selber an, und obwohl sich beim Betrachter die<br />
Gewissheit herauskristallisiert, dass es sich um montierte Bilder handelt, ist es dennoch<br />
ein beklemmendes Gefühl, die Fausthiebe der Protagonistin gegen ihr Alter<br />
Abb. 6<br />
Ego gerichtet zu sehen. Hier geht es um weit mehr als einen Boxkampf, hier geht es<br />
Abb. 7<br />
Olympe 21/05