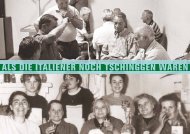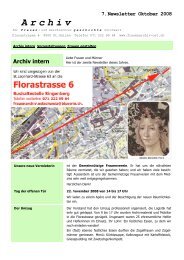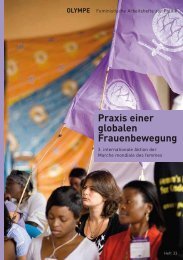Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Sportlerinnen. Spitzenleistungen vor leeren Rängen?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wenn frauen kicken …<br />
Marianne Meier<br />
1999 wurde das Finalspiel der Frauenfussball-WM in Kalifornien von 90'125 Zuschauern<br />
und Zuschauerinnen live im Stadion verfolgt, darunter auch US-Präsident<br />
Bill Clinton. Dabei handelte es sich um die grösste Publikumskulisse, welche je für<br />
72 eine Frauensportveranstaltung registriert wurde. Während die Fifa gegen Ende des<br />
nungen dem Sport also fundamentale Begriffe, die sich im Verlauf der Jahrzehnte 73<br />
letzten Jahrhunderts weltweit an die 30 Millionen Fussballerinnen zählte, kicken in<br />
der Schweiz zurzeit über 13'000 lizenzierte Frauen und Mädchen das runde Leder,<br />
Tendenz klar steigend.<br />
Geschlechtsneutralität von Sportarten<br />
Zum Fussballspielen braucht es zwei Teams mit je elf Personen, ein abgegrenztes<br />
Spielfeld, zwei Tore von derselben Grösse und einen aufgepumpten Ball. Der Sport<br />
selber hat kein Geschlecht. Wie kann es also sein, dass einer Sportart auf dem einen<br />
Kontinent das Attribut «typisch männlich» zugeschrieben wird, während das<br />
identische Spiel auf einem anderen Erdteil überwiegend als «weibliche Aktivität»<br />
verstanden wird?<br />
Wenn das runde Leder einem Mann <strong>vor</strong> die Füsse fällt, handelt es sich um einen<br />
Fussballer. Wenn derselbe Ball von einer Frau getreten wird, haben wir es mit einer<br />
Fussballerin zu tun. Obwohl diese Aussage mehr als banal erscheint, ist dieses<br />
terminologische Faktum auch im 21. Jahrhundert noch keineswegs eine Selbstverständlichkeit.<br />
Begriffe wie «Frauenfussballerin» sind nach wie <strong>vor</strong> an der Tagesordnung,<br />
wobei diese doppelte Weiblichkeitsform kaum auffällt oder hinterfragt<br />
wird. Im Gegensatz dazu stellt der Ausdruck «Männerfussball» in unserer heutigen<br />
Gesellschaft eine Tautologie dar und wird kaum verwendet. 1976 verstand Sportbuchautor<br />
Wehlen den Spielgedanken des Fussballsports wie folgt: «Fussball ist ein<br />
Olympe 21/05<br />
Mannschafts- und Kombinationsspiel besonders für Männer, bei dem es gilt, den<br />
Ball ausser mit Hand und Arm ins gegnerische Tor zu spielen.» 1 Derselbe Autor<br />
wies jedoch bei den Definitionen von Hockey, Handball, Basketball, Badminton,<br />
Volleyball und Tennis ausdrücklich darauf hin, dass diese Sportarten «für Frauen<br />
oder Männer» geeignet seien. Obwohl diese Einschätzungen in Bezug auf die Ausübungspopulation<br />
primär deskriptiven Charakter besitzen – dem damaligen Zeitgeist<br />
entsprechende Denkmuster beschreibend –, vermitteln sie auch ausgrenzend kategorisierende<br />
Gesellschaftsnormen. Bereits in den 1950er Jahren versuchte der Anthropologe<br />
Buytendijk das Treten als unweibliche Bewegung zu taxieren. 2 Bis zum<br />
heutigen Tag konnte jedoch keine Studie anatomisch-biologische Gründe liefern,<br />
die eine Einschränkung des Fussballsports für Frauen und Mädchen in irgendeiner<br />
Form rechtfertigen würde.<br />
Mannschaften und frauschaften<br />
Ein Blick in die Vergangenheit verdeutlicht die geschlechtsspezifische Prägung unserer<br />
Sport- und Spielkultur. Begriffe wie «Mannschaftsspiel» oder «Manndeckung»<br />
weisen auf die ursprünglich klar männlich dominierte Sphäre der sportlichen Aktivität<br />
hin. 3 Dieser etymologischen Betrachtung folgend, liefern männliche Bezeich-<br />
im gängigen Vokabular etabliert haben. Geschlechtsspezifische Wortwurzeln werden<br />
noch heute – oft unbewusst – verwendet und als «neutral» empfunden. Der<br />
im Sport häufig verwendete Mannschaftsbegriff gilt dabei als Paradebeispiel: Während<br />
beim Wort «Ski-Nationalmannschaft» oder «Volleyball-Mannschaft» keineswegs<br />
Klarheit über das Geschlecht der betreffenden Gruppe besteht, impliziert<br />
der Begriff «Fussballmannschaft» geradezu männliche Akteure. Das entscheidende<br />
geschlechtsspezifische Moment scheint in unserem Sprachverständnis also weniger<br />
im Begriff «Mannschaft» als im «Fussball» zu liegen. Der neutrale Charakter des<br />
Mannschaftsbegriffs kommt z.B. in der Bezeichnung «Herren-Nationalmannschaft»<br />
zum Ausdruck. Die Verwendung der «Frauschaft» versucht einen terminologischen<br />
Gegenpol zu schaffen, wobei der geschlechtsspezifische Aspekt in den Vordergrund<br />
rückt. Trotz der etymologisch eindeutig ersichtlichen Wurzeln herrscht der<br />
Mannschaftsbegriff in der heutigen Alltagssprache auch in Frauenteams (noch) <strong>vor</strong>.<br />
Die Akteurinnen verwenden den Begriff als geschlechtsneutrales Synonym für ein<br />
sporttreibendes Kollektiv.<br />
Um die Terminologie zu neutralisieren, greift der emanzipierte deutsche Sprachgebrauch<br />
des 21. Jahrhunderts – einen Kompromiss suchend – zunehmend auf das<br />
französische «Equipe» oder das englische «Team» zurück. Letztere Bezeichnung<br />
wird der klassischen «Mannschaft» in Zukunft wohl definitiv den Rang ablaufen<br />
und den ursprünglichen Begriff schon bald antiquiert anmuten lassen.