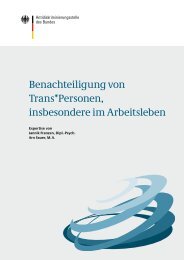Mehrdimensionale Diskriminierung – Begriffe, Theorien und ...
Mehrdimensionale Diskriminierung – Begriffe, Theorien und ...
Mehrdimensionale Diskriminierung – Begriffe, Theorien und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verhältnissen. Damit wenden sich die Autorinnen gegen eine zu starke Konzentration auf<br />
eine individuelle Ebene von Subjekten <strong>und</strong> deren Identitäten <strong>und</strong> Erfahrungen, die „starke<br />
Konzentration auf mikro- bis mesotheoretische Aspekte von Identität <strong>und</strong> <strong>Diskriminierung</strong>“<br />
68 . Was sich hier „kreuzt“ sind also Strukturen. Es geht um strukturelle <strong>Diskriminierung</strong><br />
<strong>und</strong> lässt sich auch gut mit institutioneller <strong>Diskriminierung</strong> verknüpfen, nach Supik:<br />
„die direkte oder indirekte Benachteiligung durch Mechanismen, die in die Organisationsstruktur<br />
gesellschaftlicher Institutionen eingelassen sind, <strong>und</strong> so ohne ‚böse Absicht einzelner‘<br />
Teilhabechancen ungleich verteilen. Sie finden statt im Ausbildungssystem, auf dem<br />
Arbeitsmarkt, oder im Ges<strong>und</strong>heitssystem, um einige Beispiele zu nennen. Sie zeigt sich<br />
häufig erst im statistischen Gruppenvergleich.“ 69<br />
Ähnlich wird von „struktureller“ <strong>Diskriminierung</strong> oft gesprochen, um Ungleichheitslagen<br />
zu kennzeichnen, die sich gesellschaftlich verfestigt haben, also individuelle Erfahrungen<br />
bedingen, aber von individuellen Absichten usw. weitgehend unabhängig funktionieren.<br />
Die drei Achsen der Ungleichheit, die nach Klinger <strong>und</strong> Knapp Beachtung finden sollen,<br />
sind Klasse, Geschlecht <strong>und</strong> „Rasse“/Ethnizität. Die Autorinnen erklären sowohl die Auswahl<br />
der Achsen als auch deren Vergleichbarkeit. Nur diese drei prägten nachhaltig<br />
Ungleichheit „nahezu aller Gesellschaften“ 70 . Sie bilden, so Klinger <strong>und</strong> Knapp, das Gr<strong>und</strong>muster<br />
gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse durch den gemeinsamen Bezug auf<br />
Arbeit, denn alle drei wirken als Strukturierung <strong>und</strong> Segregation des Arbeitsmarkts, insgesamt<br />
der Reproduktions- <strong>und</strong> der Erwerbsarbeit. „Rasse“, Klasse <strong>und</strong> Geschlecht dienten der<br />
Legitimation der Abwertung bestimmter Tätigkeiten, durch die je spezifische, aber strukturell<br />
vergleichbare <strong>und</strong> sich wechselseitig informierende Erzeugung von Fremdheitseffekten.<br />
Damit liegt ein interkategorialer Ansatz vor. Empirisch lässt sich so das Zusammenwirken<br />
verschiedener Ungleichheiten beispielsweise bezüglich des „pay gap“ auf dem<br />
Erwerbsarbeitsmarkt untersuchen. Klinger <strong>und</strong> Knapp meinen das aber auch programmatisch:<br />
„Für uns steht außer Zweifel, dass die inter-kategoriale Zugangsweise das eigentliche Ziel ist,<br />
das allerdings noch in weiter Ferne steht.“ 71<br />
Das Konzept ist damit für ein Verständnis von mehrdimensionaler <strong>Diskriminierung</strong> im<br />
Bereich des AGG produktiv. Es ermöglicht, die in § 1 AGG genannten „Gründe“ als „Achsen<br />
der Ungleichheit“ zu begreifen, auf denen sich dann Benachteiligungssituationen abspielen,<br />
die als <strong>Diskriminierung</strong> untersagt sind.<br />
68 Klinger/Knapp (2007), 35 f.<br />
69 Supik (2008), 2; s. a. Gomolla/Radtke (2007); Hormel/Scherr (2004).<br />
70 Klinger/Knapp (2007), 20.<br />
71 Klinger/Knapp (2007), 36.<br />
19