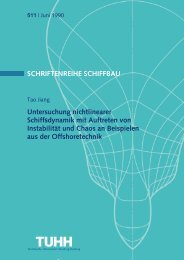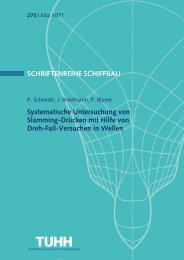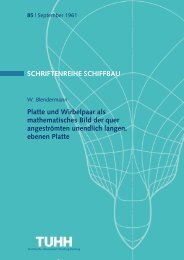SCHRIFTENREIHE SCHIFFBAU Festschrift anlässlich des 100 ...
SCHRIFTENREIHE SCHIFFBAU Festschrift anlässlich des 100 ...
SCHRIFTENREIHE SCHIFFBAU Festschrift anlässlich des 100 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60<br />
Leckstabilitätsberechnungen durch Monte Carlo Simulationen<br />
S. Krüger, H. Dankowski, F.-I. Kehren, TU Hamburg-Harburg<br />
1. Einführung in die Problematik<br />
Etwa 40 Jahre nach Einführung probabilistischer Konzepte in die Frage der Unterteilung von<br />
Schiffen durch Wendel kann man heute mit Recht behaupten, dass diese Methodik zum<br />
allgemeinen Standard bei der Bewertung der Lecksicherheit von Schiffen geworden ist.<br />
Insbesondere die gerade erfolgte Umstellung <strong>des</strong> Lecksicherheitsnachweises von<br />
Passagierschiffen auf ein probabilistisches Konzept bestätigt das. Dabei besteht das Prinzip<br />
der probabilistischen Leckrechnung darin, einen Überlebensindex zu bestimmen, der sich<br />
aus der statistischen Trefferwahrscheinlichkeit eines Raumes oder einer Raumgruppe sowie<br />
der dazu gehörigen Überlebenswahrscheinlichkeit zusammensetzt. Die Trefferwahrscheinlichkeit<br />
wird dabei aufgrund von vorliegenden Statistiken der Verteilung von Leckgröße<br />
und Lecklage ermittelt. Bezüglich der Wahrscheinlichkeit <strong>des</strong> Überstehens von<br />
Beschädigungen werden bestimmte Forderungen an die Endschwimmlage sowie an die<br />
Hebelarmkurve gestellt. Im Einzelfall muss darüber hinaus auch nachgewiesen werden, dass<br />
die Endschwimmlage tatsächlich erreicht werden kann. Dabei besteht das Ziel der<br />
Leckrechnung dann darin, für eine als gegeben angenommene Unterteilung den Grenzwert<br />
für die Höhe <strong>des</strong> Gewichtsschwerpunktes festzulegen, für den gerade noch gilt, dass der<br />
geforderte Überlebensindex gerade so groß ist wie der mit der gewählten Unterteilung<br />
erreichbare Index. Damit ergibt sich als Entwurfsproblem die Aufgabe, eine Kgmax- oder<br />
Gmreq-Kurve festzulegen. Weil die Forderungen der Leckrechnung bei fast allen Schiffen zu<br />
höheren Stabilitätsforderungen als die Intaktregeln führen (lediglich bei Schiffen mit extrem<br />
großen Windlateralflächen kann das sogenannte Wetter- Kriterium zu höheren Forderungen<br />
führen), schlägt damit die Leckrechnung in erheblichem Maße auf den gesamten<br />
Schiffsentwurf durch. Von daher liegt es im elementaren Interesse <strong>des</strong> Schiffsentwurfs,<br />
möglichst frühzeitig eine gesicherte Erkenntnis darüber zu erlangen, mit welcher<br />
Min<strong>des</strong>tstabilität ein Entwurf ausgestattet sein muss, um die sich aus der Leckrechung<br />
ergebenden Forderungen zu erfüllen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Leckrechnung<br />
gleichzeitig an zwei verschiedene (bei den neuen Regeln nach SOLAS 2009 sogar an drei<br />
verschiedene) Tiefgänge gekoppelt ist, deren Teilbeiträge dann zum eigentlichen<br />
Überlebensindex aufsummiert werden. Für jeden der zwei (oder ab 2009 dann drei)<br />
Tiefgänge kann der Entwurfsingenieur die zugrunde liegenden Schwerpunktshöhen frei<br />
wählen. Weil jede Schiffsseite abgerechnet werden muss, entsteht dadurch ein erheblicher<br />
Rechenaufwand, zumal der Entwurfsingenieur ein Interesse daran hat, möglichst viele Fälle<br />
zu identifizieren, die einen Beitrag zum Überleben <strong>des</strong> Schiffes bringen. Weil nun wegen der<br />
Berechnung der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeiten jeder Mehrabteilungsfall mit sich<br />
bringt, dass die bereits in dem Mehrabteilungsfall enthaltenen Unterfälle abzuziehen sind,<br />
nimmt die Menge an zu betrachtenden Fällen erheblich zu, gleichzeitig wird es für den<br />
Entwurfsingenieur immer aufwändiger, noch zu erkennen, wo sein Entwurf vielleicht noch<br />
Potential hat. Ferner beruht die tatsächliche Berechnung der Trefferwahrscheinlichkeit nach<br />
den sogenannten Explanatory Notes (das sind Erläuterungen zum eigentlichen<br />
Vorschriftentext) auf dem Prinzip der Mustererkennung, weshalb es in der Vergangenheit nur<br />
schwer möglich war, die Berechnungen komplett zu automatisieren. Erschwerend – und am<br />
eigentlichen Problem vorbeigehend – kommt hinzu, dass die Komplexität der<br />
Beschädigungsgenerierung mit der Komplexität der inneren Unterteilung stark zunimmt,<br />
obwohl die eigentliche Beschädigung als unabhängig von der inneren Unterteilung <strong>des</strong><br />
Schiffes angenommen werden kann (nicht aber deren Wirkung).