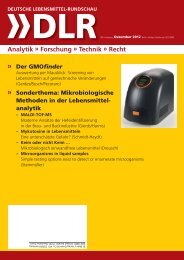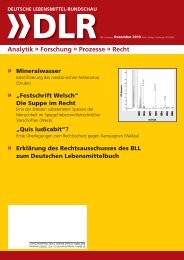Nanotechnologie in Lebensmitteln - DLR Online: Deutsche ...
Nanotechnologie in Lebensmitteln - DLR Online: Deutsche ...
Nanotechnologie in Lebensmitteln - DLR Online: Deutsche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
36<br />
Orig<strong>in</strong>alarbeiten «<br />
Damit wird deutlich, dass der deutsche Gesetzgeber den<br />
Begriff „Risiko“ sehr weit auslegt: er bezieht neben Gesundheitsrisiken<br />
auch die Risiken e<strong>in</strong>er wertgem<strong>in</strong>derten<br />
Zusammensetzung oder fehlerhaften Deklaration/Aufmachung<br />
e<strong>in</strong> und berücksichtigt somit neben dem Gesundheitsschutz<br />
auch den Täuschungsschutz.<br />
Wegen der EU-rechtlichen Verpflichtung zur Durchführung<br />
e<strong>in</strong>er risikoorientierten Überwachung des Verkehrs mit <strong>Lebensmitteln</strong><br />
wurden für diesen Bereich bereits verschiedene<br />
Konzepte entwickelt und publiziert. Die Kernpunkte der<br />
bisherigen Konzepte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:<br />
• Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Bundesverbandes der Lebensmittelchemiker/-<strong>in</strong>nen<br />
im öffentlichen Dienst (BLC)<br />
schlägt e<strong>in</strong> zweistufiges Modell 3) vor, welches sowohl auf<br />
das Produkt als auch auf den Hersteller bezogene Risikoaspekte<br />
berücksichtigt. Neben dem Gesundheitsschutz<br />
soll auch der Täuschungsschutz angemessen berücksichtigt<br />
werden. Die Beteiligung aller mit der Durchführung<br />
der Lebensmittelüberwachung befassten Stellen an der<br />
risikoorientierten Probenplanung wird als unerlässlich<br />
angesehen.<br />
• Das baden-württembergische Konzept 4) stellt das produktbezogene<br />
Risiko <strong>in</strong> den Vordergrund und basiert auf<br />
den drei Kriterien Gesundheitsrelevanz, Überwachungsrelevanz<br />
und Ernährungsrelevanz, die entsprechend ihrer<br />
Bedeutung gewichtet werden (Gesundheitsrelevanz am<br />
stärksten). Anhand dieser Kriterien erfolgt e<strong>in</strong>e Risikoabschätzung<br />
der Warenobergruppen, aus der sich der relative<br />
Anteil der e<strong>in</strong>zelnen Warengruppen am Probenkont<strong>in</strong>gent<br />
ergibt.<br />
• Das von Preuß vorgeschlagene Modell 5) ist primär betriebsorientiert.<br />
Da die Lebensmittelunternehmer nach<br />
der EG-Basis-VO (EG/178/2002) die primäre Verantwortung<br />
für die Lebensmittelsicherheit tragen, muss<br />
nach Auffassung von Preuß das Kontrollsystem auf dem<br />
Unternehmerrisiko aufgebaut se<strong>in</strong>, das durch Bewertung<br />
se<strong>in</strong>er Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie se<strong>in</strong>er<br />
früheren Rechtsverstöße ermittelt werden kann.<br />
• In Ostwestfalen-Lippe wurde e<strong>in</strong> Konzept entwickelt 6) ,<br />
<strong>in</strong> dem der Schwerpunkt der risikoorientiert zu entnehmenden<br />
Proben auf Hersteller und Importeure gelegt<br />
wurde. Die Probenzahlen sollen mit Hilfe e<strong>in</strong>er Formel<br />
– unter Berücksichtigung von betriebs- und produktspezifischen<br />
Faktoren – ermittelt werden. Groß- und E<strong>in</strong>zelhandelsbetriebe<br />
sowie Gastronomiee<strong>in</strong>richtungen<br />
werden mit Probenpauschalen belegt, die aus Erfahrungswerten<br />
abzuleiten s<strong>in</strong>d und am Produktrisiko und<br />
der Geschäftsgröße orientiert s<strong>in</strong>d.<br />
Auf diese Weise können mit größerer Effizienz die stärker<br />
risikobehafteten Produkte am Markt herausgefiltert werden.<br />
Da für den Kosmetikbereich noch ke<strong>in</strong>erlei publizierte<br />
Konzepte vorliegen, wurde von den Sachverständigen mehrerer<br />
Bundesländer das nachstehende geme<strong>in</strong>same Konzept<br />
zur risikoorientierten Probenplanung im Bereich Kosmetiküberwachung<br />
entwickelt.<br />
2 Grundpr<strong>in</strong>zip „Drei-Säulen-Modell“<br />
Aus allen vorgenannten Publikationen wird sehr deutlich,<br />
dass e<strong>in</strong>e Risikoanalyse e<strong>in</strong> multifaktorielles Geschehen ist,<br />
<strong>in</strong> das e<strong>in</strong>e Vielzahl an E<strong>in</strong>zelkriterien e<strong>in</strong>fließt. Werden alle<br />
Faktoren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zigen Formel zusammengeführt, um<br />
daraus die risikoorientierten Probenzahlen für die verschiedenen<br />
Warengruppen festzulegen, besteht die Gefahr e<strong>in</strong>er<br />
gewissen Nivellierung: Warengruppen, die sehr häufig und<br />
<strong>in</strong> großer Menge verzehrt bzw. im Falle von kosmetischen<br />
Mitteln angewendet werden, jedoch erfahrungsgemäß wenig<br />
mit gesundheitlichen Risiken verbunden s<strong>in</strong>d, werden<br />
<strong>in</strong> gleichem Umfang beprobt wie Produktgruppen mit ger<strong>in</strong>ger<br />
Anwendungsmenge/Marktrelevanz, aber möglichem<br />
hohen Risiko. So schwanken beispielsweise die prozentualen<br />
Probenanteile der verschiedenen Lebensmittelgruppen<br />
im Konzept 4) lediglich zwischen 1,6 % (We<strong>in</strong>erzeugnisse,<br />
we<strong>in</strong>ähnliche Getränke) bis 4,8 % (Fertiggerichte, Fe<strong>in</strong>kostsalate).<br />
E<strong>in</strong>e analoge Anwendung dieses Konzeptes auf<br />
kosmetische Mittel würde beispielsweise dazu führen, dass<br />
Zahnbleichmittel ebenso stark beprobt würden wie Hautpflegemittel.<br />
Dies ist jedoch nicht s<strong>in</strong>nvoll, da sich das Warenangebot<br />
<strong>in</strong> der Warengruppe Hautpflegemittel alljährlich<br />
stark verändert, d. h. viele Produkt<strong>in</strong>novationen auf<br />
den Markt kommen und e<strong>in</strong>e große Vielfalt der Produkte<br />
und verwendeten Wirkstoffe besteht, während die Warengruppe<br />
Zahnbleichmittel nur gelegentlich Neuerungen erfährt<br />
und danach jahrelang unverändert auf dem Markt<br />
ist.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist es bei diesem Verfahren sehr schwierig,<br />
die Betriebsrisikofaktoren zu berücksichtigen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
da große Kosmetikbetriebe Produkte aus unterschiedlichen<br />
Warengruppen herstellen. E<strong>in</strong>e ausschließliche Fokussierung<br />
auf das Betriebsrisiko wie <strong>in</strong> Ref. 5) vorgeschlagen ersche<strong>in</strong>t<br />
zu eng gefasst und lässt e<strong>in</strong>ige verbraucherschutzrelevante<br />
Aspekte unberücksichtigt.<br />
Um den vielfältigen, teils gegenläufigen Risikofaktoren angemessen<br />
Rechnung zu tragen, sollen diese <strong>in</strong> drei getrennten<br />
Säulen erfasst werden.<br />
Säule 1: Betriebsbezogene Risiken<br />
Erfasst werden Risiken, die alle<strong>in</strong> von betrieblichen Besonderheiten<br />
abhängen (z. B. produktions<strong>in</strong>terne Kontam<strong>in</strong>ationsprozesse,<br />
Qualität der Produktunterlagen gemäß § 5b<br />
KosmetikV bei Importeuren). Grundlage ist die Risikobewertung<br />
der Betriebe durch die zuständigen Behörden <strong>in</strong><br />
Kooperation mit den Sachverständigen der Untersuchungsämter.<br />
Aus dieser Bewertung ergibt sich die Kontrollfrequenz<br />
und <strong>in</strong> Konsequenz die Entnahme von Proben <strong>in</strong> den<br />
als unterschiedlich kritisch e<strong>in</strong>gestuften Betrieben. Beprobt<br />
werden hier die Hersteller und Importeure.<br />
Säule 2: Verbraucherbezogene Risiken<br />
Diese Säule der Beprobung dient der Berücksichtigung<br />
e<strong>in</strong>es möglichen Risikos <strong>in</strong> Abhängigkeit von der Exposition<br />
(Anwendungsmenge und -häufigkeit) der Verbraucher<br />
gegenüber dem jeweiligen kosmetischen Mittel. Auch der<br />
» November/Dezember 2008 | <strong>DLR</strong>