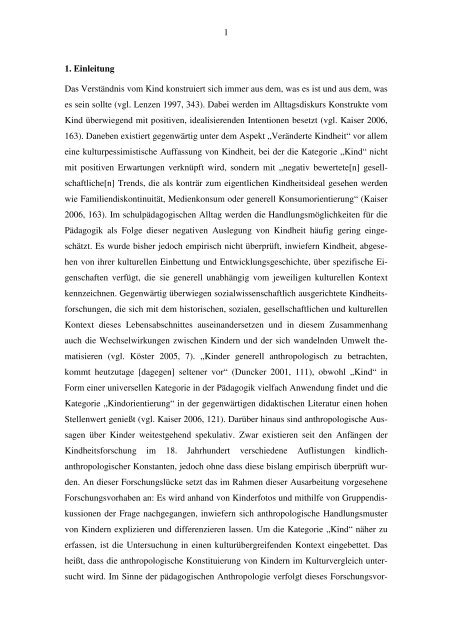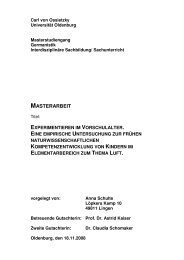Ma-Arbeit Stine Albers - Kinderforschung - Carl von Ossietzky ...
Ma-Arbeit Stine Albers - Kinderforschung - Carl von Ossietzky ...
Ma-Arbeit Stine Albers - Kinderforschung - Carl von Ossietzky ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Einleitung<br />
1<br />
Das Verständnis vom Kind konstruiert sich immer aus dem, was es ist und aus dem, was<br />
es sein sollte (vgl. Lenzen 1997, 343). Dabei werden im Alltagsdiskurs Konstrukte vom<br />
Kind überwiegend mit positiven, idealisierenden Intentionen besetzt (vgl. Kaiser 2006,<br />
163). Daneben existiert gegenwärtig unter dem Aspekt „Veränderte Kindheit“ vor allem<br />
eine kulturpessimistische Auffassung <strong>von</strong> Kindheit, bei der die Kategorie „Kind“ nicht<br />
mit positiven Erwartungen verknüpft wird, sondern mit „negativ bewertete[n] gesell-<br />
schaftliche[n] Trends, die als konträr zum eigentlichen Kindheitsideal gesehen werden<br />
wie Familiendiskontinuität, Medienkonsum oder generell Konsumorientierung“ (Kaiser<br />
2006, 163). Im schulpädagogischen Alltag werden die Handlungsmöglichkeiten für die<br />
Pädagogik als Folge dieser negativen Auslegung <strong>von</strong> Kindheit häufig gering einge-<br />
schätzt. Es wurde bisher jedoch empirisch nicht überprüft, inwiefern Kindheit, abgese-<br />
hen <strong>von</strong> ihrer kulturellen Einbettung und Entwicklungsgeschichte, über spezifische Ei-<br />
genschaften verfügt, die sie generell unabhängig vom jeweiligen kulturellen Kontext<br />
kennzeichnen. Gegenwärtig überwiegen sozialwissenschaftlich ausgerichtete Kindheits-<br />
forschungen, die sich mit dem historischen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen<br />
Kontext dieses Lebensabschnittes auseinandersetzen und in diesem Zusammenhang<br />
auch die Wechselwirkungen zwischen Kindern und der sich wandelnden Umwelt the-<br />
matisieren (vgl. Köster 2005, 7). „Kinder generell anthropologisch zu betrachten,<br />
kommt heutzutage [dagegen] seltener vor“ (Duncker 2001, 111), obwohl „Kind“ in<br />
Form einer universellen Kategorie in der Pädagogik vielfach Anwendung findet und die<br />
Kategorie „Kindorientierung“ in der gegenwärtigen didaktischen Literatur einen hohen<br />
Stellenwert genießt (vgl. Kaiser 2006, 121). Darüber hinaus sind anthropologische Aus-<br />
sagen über Kinder weitestgehend spekulativ. Zwar existieren seit den Anfängen der<br />
Kindheitsforschung im 18. Jahrhundert verschiedene Auflistungen kindlich-<br />
anthropologischer Konstanten, jedoch ohne dass diese bislang empirisch überprüft wur-<br />
den. An dieser Forschungslücke setzt das im Rahmen dieser Ausarbeitung vorgesehene<br />
Forschungsvorhaben an: Es wird anhand <strong>von</strong> Kinderfotos und mithilfe <strong>von</strong> Gruppendis-<br />
kussionen der Frage nachgegangen, inwiefern sich anthropologische Handlungsmuster<br />
<strong>von</strong> Kindern explizieren und differenzieren lassen. Um die Kategorie „Kind“ näher zu<br />
erfassen, ist die Untersuchung in einen kulturübergreifenden Kontext eingebettet. Das<br />
heißt, dass die anthropologische Konstituierung <strong>von</strong> Kindern im Kulturvergleich unter-<br />
sucht wird. Im Sinne der pädagogischen Anthropologie verfolgt dieses Forschungsvor-