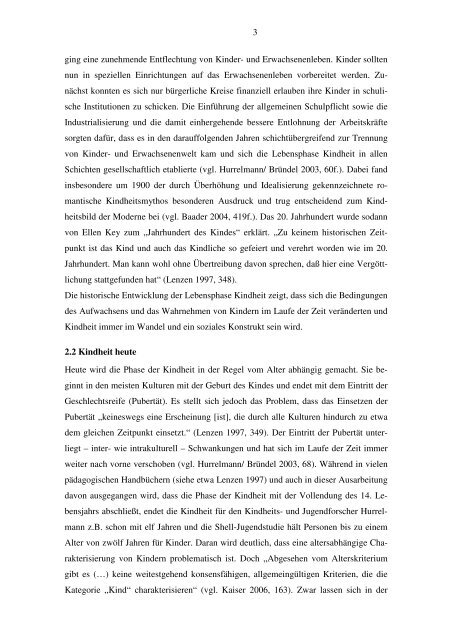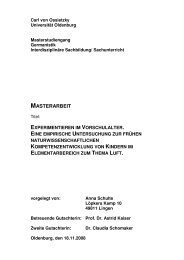Ma-Arbeit Stine Albers - Kinderforschung - Carl von Ossietzky ...
Ma-Arbeit Stine Albers - Kinderforschung - Carl von Ossietzky ...
Ma-Arbeit Stine Albers - Kinderforschung - Carl von Ossietzky ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ging eine zunehmende Entflechtung <strong>von</strong> Kinder- und Erwachsenenleben. Kinder sollten<br />
nun in speziellen Einrichtungen auf das Erwachsenenleben vorbereitet werden. Zu-<br />
nächst konnten es sich nur bürgerliche Kreise finanziell erlauben ihre Kinder in schuli-<br />
sche Institutionen zu schicken. Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht sowie die<br />
Industrialisierung und die damit einhergehende bessere Entlohnung der <strong>Arbeit</strong>skräfte<br />
sorgten dafür, dass es in den darauffolgenden Jahren schichtübergreifend zur Trennung<br />
<strong>von</strong> Kinder- und Erwachsenenwelt kam und sich die Lebensphase Kindheit in allen<br />
Schichten gesellschaftlich etablierte (vgl. Hurrelmann/ Bründel 2003, 60f.). Dabei fand<br />
insbesondere um 1900 der durch Überhöhung und Idealisierung gekennzeichnete ro-<br />
mantische Kindheitsmythos besonderen Ausdruck und trug entscheidend zum Kind-<br />
heitsbild der Moderne bei (vgl. Baader 2004, 419f.). Das 20. Jahrhundert wurde sodann<br />
<strong>von</strong> Ellen Key zum „Jahrhundert des Kindes“ erklärt. „Zu keinem historischen Zeit-<br />
punkt ist das Kind und auch das Kindliche so gefeiert und verehrt worden wie im 20.<br />
Jahrhundert. <strong>Ma</strong>n kann wohl ohne Übertreibung da<strong>von</strong> sprechen, daß hier eine Vergött-<br />
lichung stattgefunden hat“ (Lenzen 1997, 348).<br />
Die historische Entwicklung der Lebensphase Kindheit zeigt, dass sich die Bedingungen<br />
des Aufwachsens und das Wahrnehmen <strong>von</strong> Kindern im Laufe der Zeit veränderten und<br />
Kindheit immer im Wandel und ein soziales Konstrukt sein wird.<br />
2.2 Kindheit heute<br />
Heute wird die Phase der Kindheit in der Regel vom Alter abhängig gemacht. Sie be-<br />
ginnt in den meisten Kulturen mit der Geburt des Kindes und endet mit dem Eintritt der<br />
Geschlechtsreife (Pubertät). Es stellt sich jedoch das Problem, dass das Einsetzen der<br />
Pubertät „keineswegs eine Erscheinung [ist], die durch alle Kulturen hindurch zu etwa<br />
dem gleichen Zeitpunkt einsetzt.“ (Lenzen 1997, 349). Der Eintritt der Pubertät unter-<br />
liegt – inter- wie intrakulturell – Schwankungen und hat sich im Laufe der Zeit immer<br />
weiter nach vorne verschoben (vgl. Hurrelmann/ Bründel 2003, 68). Während in vielen<br />
pädagogischen Handbüchern (siehe etwa Lenzen 1997) und auch in dieser Ausarbeitung<br />
da<strong>von</strong> ausgegangen wird, dass die Phase der Kindheit mit der Vollendung des 14. Le-<br />
bensjahrs abschließt, endet die Kindheit für den Kindheits- und Jugendforscher Hurrel-<br />
mann z.B. schon mit elf Jahren und die Shell-Jugendstudie hält Personen bis zu einem<br />
Alter <strong>von</strong> zwölf Jahren für Kinder. Daran wird deutlich, dass eine altersabhängige Cha-<br />
rakterisierung <strong>von</strong> Kindern problematisch ist. Doch „Abgesehen vom Alterskriterium<br />
gibt es (…) keine weitestgehend konsensfähigen, allgemeingültigen Kriterien, die die<br />
Kategorie „Kind“ charakterisieren“ (vgl. Kaiser 2006, 163). Zwar lassen sich in der<br />
3