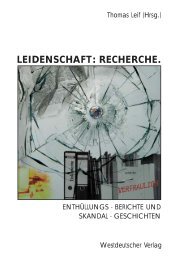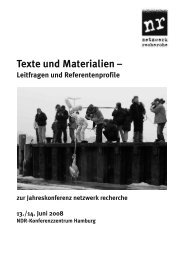Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Veranstaltungen und <strong>Materialien</strong><br />
Raum K1<br />
K1<br />
Freitag, 1. Juli, 10:30<br />
Moral? Ethik? Haltung? – Diskussion zur Lage des deutschen Journalismus<br />
Mit: Georg Mascolo, Giovanni di Lorenzo, Hans Leyendecker, Ines Pohl<br />
K1<br />
Freitag, 1. Juli, 11:45<br />
Kachelmann & Co. – Wenn Journalisten zu Richtern werden<br />
Mit: Kuno Haberbusch, Ralf Höcker, Rudolf Gerhardt, Sabine Rückert, Tanit Koch<br />
Leitfragen:<br />
Relevanz der Gerichtsberichterstattung: Wieso ist Gerichtsberichterstattung wichtig? Was macht gerade den Fall<br />
Kachelmann für die Öffentlichkeit relevant? Was macht ihn interessant? Promi-Malus oder -Bonus? Ein Beispiel für<br />
Vergewaltigungsprozesse in Deutschland (vgl. Argumentation Schwarzer)? Verfahrensfehler? Litigation PR?<br />
Die Rolle des Journalisten: Testis oder Superstes? Wie objektiv können wir sein? Kann ein Journalist objektiv sein,<br />
wenn er sich mit einer Sache gemein macht, selbst wenn es eine gute Sache ist? Bsp.: Schwarzer – zwischen<br />
Feminismus und Journalismus; Einberufung in den Zeugenstand Muss das ein Widerspruch sein?<br />
Vorverurteilung durch die Medien: Wenn mutmaßliche Täter zu medialen Opfern werde. Wie wirkt sich die Berichterstattung<br />
auf die Öffentlichkeit aus? Was verändert sie in der Wahrnehmung der Leser? Was verändert sie in der<br />
Wahrnehmung der Richter/Gerichte? Wo hört subjektive Objektivität auf, wo fängt Verurteilung an?<br />
Litigation PR Wenn Medien zu Instrumenten werden: Welchen Einfluss hat die Litigation PR auf die Berichterstattung?<br />
Lassen wir uns instrumentalisieren? Steht uns eine unaufhaltsame Boulevardisierung bevor?<br />
Ethische (und juristische) Grenzen der Gerichtsberichterstattung: Sensationslust vs. Neuigkeitswert, Theorie vs.<br />
Praxis. Nutzen wir die Sonderstellung der Medien aus? Unterschätzen wir die Macht der Medien? Reicht die Selbstkontrolle<br />
der Medien noch aus oder braucht es neue Formen der Medienkontrolle? Berufsethos, Kontrollorgane<br />
und Selbsteinschätzung auf dem Prüfstand.<br />
--<br />
PROF. DR. RUDOLF GERHARDT<br />
Relevanz der Gerichtsberichterstattung: Wieso ist Gerichtsberichterstattung wichtig? Was macht gerade den Fall<br />
Kachelmann für die Öffentlichkeit relevant? Was macht ihn interessant? Promi-Malus oder -Bonus? Ein Beispiel für<br />
Vergewaltigungsprozesse in Deutschland (vgl. Argumentation Schwarzer)? Verfahrensfehler? Litigation PR?<br />
Jede Demokratie lebt – auch – von der Macht-Kontrolle. Ohne eine solche Kontrolle steht die Tür zur Willkür offen.<br />
Die Justiz ist die Dritte Staatsgewalt, und sie ist es, die der Bürger eigentlich persönlich zu spüren bekommt,<br />
wenn er vor Gericht steht – hautnah, so könnte man sagen. Also braucht die Justiz ihre Kontrolle auch außerhalb<br />
des Instanzenzugs – die Kontrolle durch die Medien.<br />
Der Fall Kachelmann ist ein schillernder Cocktail, den Medien ihren „Kunden“ auftischen: Erstens: Sex sells<br />
Zweitens: Der „Hauptdarsteller“ ist ein bekannter Mann von großem öffentlichen Interesse Drittens: Es ist eine<br />
Frau, die in die Rolle des (angeblichen) Opfers geraten war. Und die Frage: Wer ist es, der da lügt, beschäftige die<br />
Gespräche an den Stammtischen.<br />
Die Rolle des Journalisten: Testis oder Superstes? Wie objektiv können wir sein? Kann ein Journalist objektiv sein,<br />
wenn er sich mit einer Sache gemein macht, selbst wenn es eine gute Sache ist? Bsp.: Schwarzer – zwischen<br />
Feminismus und Journalismus; Einberufung in den Zeugenstand Muss das ein Widerspruch sein?<br />
Kein Mensch ist ganz objektiv, auch keine Journalist. „Objektiv ist jemand, der sich seiner Subjektivität bewußt<br />
ist“. D.h.: Wir alle müssen uns permanent um Objektivität bemühen.<br />
Und wir Journalisten dürfen zwar parteiisch empfinden, aber nicht parteiisch schreiben, solange das Urteil nicht<br />
gesprochen ist. Vor-Verurteilung oder Vorfreispruch ist unsere Sache nicht. Wir sind keine Richter.<br />
Schon gar nicht in einem Fall wie Kachelmann, wo Aussage gegen Aussage steht. Bis zum Urteil müssen auch wir<br />
uns an die Unschuldvermutung halten – und unsere kritische Distanz wahren.<br />
Aber wir beurteilen das Urteil des Gerichts.<br />
Vorverurteilung durch die Medien: Wenn mutmaßliche Täter zu medialen Opfern werden ... Wie wirkt sich die Berichterstattung<br />
auf die Öffentlichkeit aus? Was verändert sie in der Wahrnehmung der Leser? Was verändert sie in<br />
der Wahrnehmung der Richter/Gerichte? Wo hört subjektive Objektivität auf, wo fängt Verurteilung an?<br />
Wenn jemand zum „medialen Opfer“ wird, sind wir die Täter. Und das dürfen – und wollen – wir natürlich nicht<br />
sein. Die Richter urteilen, wir be-urteilen. Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.<br />
Eine empirische Umfrage, die ich zusammen mit Herrn Kepplinger gemacht habe, hat gezeigt, daß die Medien<br />
Einfluß auf die Strafjustiz haben: Auf die Atmosphäre im Gerichtssaal, auf die Höhe der Strafe, auf die Frage der<br />
Bewährung. Wichtig: Nicht auf die Schuldfrage!<br />
Diese Umfrage hat auch in der Justiz starke Beachtung erfahren.<br />
Litigation PR: Wenn Medien zu Instrumenten werden ... Welchen Einfluss hat die Litigation PR auf die Berichterstattung?<br />
Lassen wir uns instrumentalisieren? Steht uns eine unaufhaltsame Boulevardisierung bevor?<br />
Wir nutzen die Sonderstellung der Medien nicht aus: Wir erfüllen auch bei Gerichtsberichterstattung nur unsere<br />
berufliche Aufgabe. Wir sind Beobachter, und – natürlich – kritische Beobachter. Und nicht Protokollanten der<br />
Justiz und der Verhandlung vor Gericht.<br />
Eine neue „Medien-Kontrolle“ brauchen wir nicht. Das Presse-Recht, das Medien-Recht ist weitgehend Richter-<br />
Recht. Und die richterliche/justitielle Macht „teilen“ sich der BGH, das BVerfG, der EGMR und der EuGH.<br />
Sie stehen in einer neuen Art von richterlichem Konkurrenzkampf. Aber das Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit<br />
und Persönlichkeitsschutz ist ausgewogen.<br />
Der Deutsche Presserat hat nur eine sanfte Macht. Aber sein Bußgeldkatalog: Hinweis, Mißbilligung. Rüge<br />
öffentliche Rüge ist hinreichend.<br />
Wir brauchen keine neuen Mediengesetze zum Persönlichkeitsschutz und sie könnten verfassungswidrig sein.<br />
Herr Kauder mag darüber nachdenken. Aber bei diesem Nachdenken sollte es bleiben.<br />
Allerdings hat der weitgehende Ausschluß der Öffentlichkeit in der Causa Kachelmann wichtige Fragen aufgeworfen.<br />
Über die sollten wir alle nachdenken.<br />
K1<br />
Freitag, 1. Juli, 13:45<br />
Personen statt Inhalte – Immer mehr politikfreie Politikberichterstattung<br />
Sind immer nur die Leser und Zuschauer Schuld, denen man keine harten politischen Stoffe zumuten kann,<br />
sondern alles am besten an Personen entlang erzählt? Für den Politikjournalismus bedeutet dies: Immer mehr<br />
Porträts von Politikern, immer weniger Analysen über politische <strong>Themen</strong>. Monatelang zum Beispiel hat sich die<br />
halbe Medienwelt auf Karl Theodor zu Guttenberg gestürzt, erst auf seinen glanzvollen Aufstieg, auf die bella<br />
figura, die er in Berlin machte, auf seine Frau und ihre TV-Jagd auf Pädophile, schließlich auf den Abstieg und<br />
Untergang des einstigen Stars, der seine Doktorarbeit zusammen geklaut hat. Erst ganz am Schluss, als Guttenberg<br />
zur persona non grata wurde, hat man auch mal genauer auf seine bescheidenen Leistungen im Verteidigungsministerium<br />
geschaut. Dieser Trend zur Personalisierung widerfährt aber nicht nur Stars wie zu Guttenberg.<br />
Selbst Annette Schavan, Philipp Rösler oder Horst Seehofer sind dankbare Gegenstände der Berliner Porträtmaler,<br />
und es ist meist das gleiche Model: Fast nie geht es um deren Politik, dafür um so leidenschaftlicher um<br />
diverse Machtspielchen: wie gut sie mit Merkel können, ob ihr Stern im Steigen oder Sinken begriffen ist, wie<br />
glaubwürdig und authentisch sie sind und wie sie beim Wähler ankommen. Es ist eine Form von Journalismus,<br />
die Politikberichterstattung eigentlich nur simuliert, tatsächlich aber ziemlich politikfrei ist. Ob Annette Schavan<br />
eine sinnvolle Forschungspolitik macht oder Philipp Rösler eine stimmige Wirtschaftspolitik erfährt der Leser fast<br />
nie. Zudem enthält bereits die journalistische Form die wichtigste Botschaft: Politiker, die porträtiert werden, sind<br />
wichtige Figuren. Das aber muss gerade in der Finanzkrise bezweifelt werden. Statt eines Porträts über Wolfgang<br />
Schäuble in der Eurokrise wäre es vermutlich viel politischer, über die Lobbyisten der Großbanken zu berichten,<br />
die es geschafft haben, dass auch drei Jahre nach der Lehmann-Pleite jede Lösung des to-big-to-fail verhindert<br />
wurde. Warum aber findet diese Form von echter, aufklärerischer Politikberichterstattung fast nicht statt? Und wie<br />
müsste ein idealer Politikjournalismus überhaupt aussehen?<br />
Mit: Arno Luik, Bettina Schausten, Christian Bommarius, Markus Grill<br />
12 13


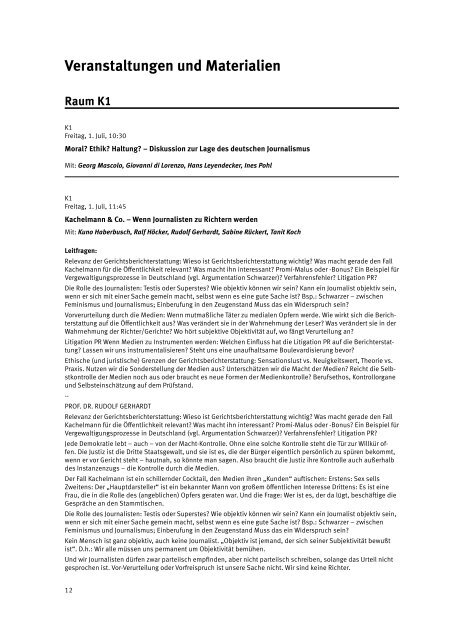
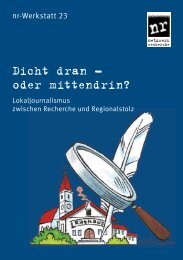
![Kurzbiografien der Referenten und ihre Themen [PDF] - Netzwerk ...](https://img.yumpu.com/21354886/1/184x260/kurzbiografien-der-referenten-und-ihre-themen-pdf-netzwerk-.jpg?quality=85)

![Rede Frank A. Meyer [PDF] - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/21238543/1/184x260/rede-frank-a-meyer-pdf-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)
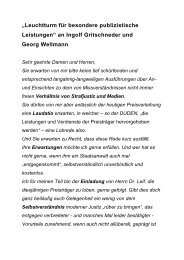




![Die stille Macht [Text] (381 S., 2.142 - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/7467581/1/184x260/die-stille-macht-text-381-s-2142-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)