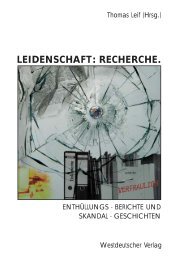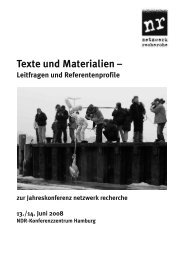Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
K3<br />
Freitag, 1. Juli, 11:45<br />
Reporter-Forum II – Neue Formen: Fotofilme und Multimedia-Reportagen<br />
Zur besten Web-Reportage 2010 hat die Jury des Reporter-Preises „After The War“ von Felix Seuffert gekürt. Eine<br />
Audio-Slideshow über einen kongolesischen Fußballer in Südafrika, produziert von der Agentur 2470media. Daniel<br />
Nauck und Kay Meseberg von 2470media zeigen in ihrem Workshop, wie man Fotofilme „dreht“ und Multimedia-Reportagen<br />
„schreibt“.<br />
Mit: Daniel Nauck, Kay Meseberg<br />
K3<br />
Freitag, 1. Juli, 12:45<br />
Reporter-Forum III – Fukushima: <strong>Recherche</strong> in verstrahlten Regionen<br />
„Der Elektriker von Reaktor 3“ und „Leben mit dem GAU“ – solche Schlagzeilen (und vor allem die Texte dazu)<br />
kann nur liefern, wer am Ort des Geschehens war.<br />
Die Spiegel-Reporter Cordula Meyer und Uwe Buse waren in Japan, um über die dortige Atom-Katastrophe zu berichten.<br />
In ihrem Workshop berichten sie von ihren <strong>Recherche</strong>-Erfahrungen.<br />
Mit: Cordula Meyer, Uwe Buse<br />
K3<br />
Freitag, 1. Juli, 13:45<br />
Reporter-Forum IV – Investigativer Journalismus beim ZEITmagazin<br />
Man kann viel über Mode und Uhren erfahren im ZEITmagazin. Aber als das Blatt am 24. Mai 2007 als Beilage der<br />
ZEIT zurückkam (damals noch als „Leben“), war kein anderer als Günter Wallraff auf dem Titel. Undercover war er<br />
für das Magazin in Call-Centern unterwegs.<br />
Wie investigativer Journalismus beim ZEITmagazin funktioniert, erklärt Redaktionsleiter Christoph Amend in seinem<br />
Workshop.<br />
Mit: Christoph Amend<br />
K3<br />
Freitag, 1. Juli, 15:00<br />
Was dürfen Reporter? – Zur Unterscheidung zwischen Erfahrenem und Erlebtem<br />
In vielen Reportagen in die sogenannte „szenische Rekonstruktion“ ein beliebtes Mittel, um wesentliche Szenen<br />
dem Leser anschaulich zu vermitteln. Muss der Leser aber dabei zwingend erfahren, dass der Reporter die beschriebene<br />
Szene gar nicht selbst erlebt hat, sondern aus Gesprächen oder Dokumenten rekonstruiert? Darf man<br />
Horst Seehofers Keller in einer Einstiegsszene beschreiben, ohne je im Keller gewesen zu sein und das dem Leser<br />
gegenüber auch nicht erwähnt. Oder andererseits: Ist das Verschweigen der Tatsache, dass man die geschilderte<br />
Szene nicht selbst erlebt oder beobachtet hat, eine verzeihbare Nachlässigkeit, weil das, was man schildert, ja<br />
stimmt, also zutreffend ist? Überhaupt: Was sagt die Lust an der szenischen Rekonstruktion über das Weltbilder<br />
Reporter aus? Pflegen die Großmeister der Reportage damit nicht einen Habitus, der zumindest seit Thomas Mann<br />
ziemlich aus der Mode gekommen ist, nämlich den Habitus des allwissenden Erzählers, der Autors, der Figuren<br />
und Szene im Griff hat und alles schlüssig erklären kann, ohne Brüche und ohne Widersprüch, der mithin also<br />
Kitsch produziert, wie Claudius Seidl (FAS) im vergangenen Jahr auf der Jahreskonferenz den Reportern vorgeworfen<br />
hat.<br />
Mit: Andreas Wolfers, Christian Bommarius, Cordt Schnibben, Ines Pohl, Peter-Matthias Gaede<br />
K3<br />
Freitag, 1. Juli, 16:15<br />
Von Tschernobyl bis Fukushima – Die Halbwertszeit des Wissens über Atomkraft<br />
Déjà-vu oder alles ganz anders: Die Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima weisen zahlreiche Parallelen<br />
auf – und fanden medial doch unter völlig anderen Rahmenbedingungen statt: Damals wenige Bilder und<br />
Nachrichten, noch dazu gefiltert durch den Eisernen Vorhang; heute steht jede Explosion in Japan live im Netz<br />
und kommt via social media direkt ins Haus oder aufs Handy. Doch wurden wir 2011 tatsächlich besser und nachhaltiger<br />
informiert als im Katastrophenjahr 1986?<br />
Mit: Fritz Vorholz, Holger Wormer, Jeanne Rubner, Ranga Yogeshwar<br />
Leitfragen:<br />
Wie unterscheidet sich Ihrem Eindruck nach die Berichterstattung über Fukushima von der Berichterstattung über<br />
Tschernobyl?<br />
Welche Rolle spielte dabei die seit Mitte der 80er Jahre veränderte Medienlandschaft (auch im Hinblick auf das<br />
Internet und social media)? Wie hat sich die „Halbwertszeit“ von Nachrichten verändert?<br />
Hat sich die Qualität der Berichterstattung der klassischen Medien im Vergleich verbessert oder haben die<br />
Medien „aus Tschernobyl nichts gelernt“?<br />
Wie bewerten Sie die schnelle Fokussierung auf innenpolitische <strong>Themen</strong> rund um deutsche Kernkraftwerke<br />
/ AKW? Bestand hier Nachholbedarf nach der zuvor eher zurückhaltenden Mediendebatte um eine<br />
Laufzeitzeitverlängerung?<br />
Wie haben Sie das Zusammenspiel zwischen den aktuellen Redaktionen und den Fachredaktionen bzw.<br />
Wissenschaftsjournalisten empfunden? Wo besteht Verbesserungsbedarf?<br />
--<br />
FRITZ VORHOLZ:<br />
Wie unterscheidet sich Ihrem Eindruck nach die Berichterstattung über Fukushima von der Berichterstattung über<br />
Tschernobyl?<br />
Zwei Aspekte: Die Tschernobyl-Katastrophe wurde auf die Unfähigkeit der russischen/sozialistischen Technik<br />
zurückgeführt. Mit diesem Argument wurde die Betroffenheit klein geredet. Und: Wir wissen heute besser als vor<br />
einem Vierteljahrhundert, dass der Verzicht auf die Atomkraft möglich ist. Allerdings war Tschernobyl keineswegs<br />
der Beginn der Atomdebatte in Deutschland. Abgesehen von den Protesten in Wyhl etc. ereignete sich 1979 der<br />
Beinahe-Super-Gau in Harrisburg, was in Deutschland zur Einsetzung einer Bundestags Enquete-Kommission<br />
„Zukünftige Kernenergiepolitik“ führte. Das hatte durchaus publizistische Relevanz. Fukushima hatte deshalb<br />
einen so starken Effekt auf die deutsche Debatte, weil es bereits einen beschlossenen Atomausstieg gegeben<br />
hatte, der allerdings gerade unter mehr oder weniger obskuren Bedingungen wieder rückgängig gemacht<br />
worden war. Ein Aspekt war 1986 ff. kaum relevant: Der tatsächliche oder vermeintliche Zielkonflikt Atomkraft<br />
vs. Klimaschutz. Fast sämtliche anderen Aspekte wurden auch damals schon thematisiert. Ich selbst arbeitete<br />
Anfang der 1980er Jahre an einem „Funkkolleg“ mit, in dem auch die ethische Problematik ausführlich<br />
thematisiert wurde.<br />
Welche Rolle spielte dabei die seit Mitte der 80er Jahre veränderte Medienlandschaft (auch im Hinblick auf das<br />
Internet und social media)? Wie hat sich die „Halbwertszeit“ von Nachrichten verändert?<br />
Die Informationsbeschaffung ist einfacher geworden, die Einordnung von Information nicht unbedingt. Beispiel:<br />
Nach der Abschaltung der 7 Altmeiler in Deutschland sind die Stromimporte gestiegen. Das ließ sich im Internet<br />
nachvollziehen (www.entsoe.net). Aber kam da wirklich französischer Atomstrom ins Land, wie gerne behauptet<br />
wurde? Das war schon sehr viel schwieriger zu beantworten und setzte einige <strong>Recherche</strong> voraus.<br />
Hat sich die Qualität der Berichterstattung der klassischen Medien im Vergleich verbessert oder haben die<br />
Medien „aus Tschernobyl nichts gelernt“?<br />
Das kann ich schwer beurteilen. Es gibt jedenfalls viel mehr Informationen als damals. Und es gibt eine<br />
neue Dimension, die Klimaproblematik. Allerdings scheinen Teile der Öffentlichkeit das erst gerade entdeckt<br />
zu haben, obwohl es schon seit 20 Jahren einen völkerrechtlichen Vertrag dazu gibt. Klimaschutz, Preise,<br />
Versorgungssicherheit – nach meinem Eindruck wird nach wie vor viel zu uninformiert über die Bedeutung der<br />
Kernenergie geschrieben. Ihr Stellenwert für die Energieversorgung der Menschheit ist z.B. laut Internationaler<br />
Energie Agentur geringer als der von getrockneten Kuhfladen und Brennholz.<br />
Wie bewerten Sie die schnelle Fokussierung auf innenpolitische <strong>Themen</strong> rund um deutsche Kernkraftwerke<br />
/ AKW? Bestand hier Nachholbedarf nach der zuvor eher zurückhaltenden Mediendebatte um eine<br />
Laufzeitzeitverlängerung?<br />
Ja, das ist ein Grund. Ein anderer ist, dass die Informationsbeschaffung in Japan offenbar sehr schwierig war/ist.<br />
24 25


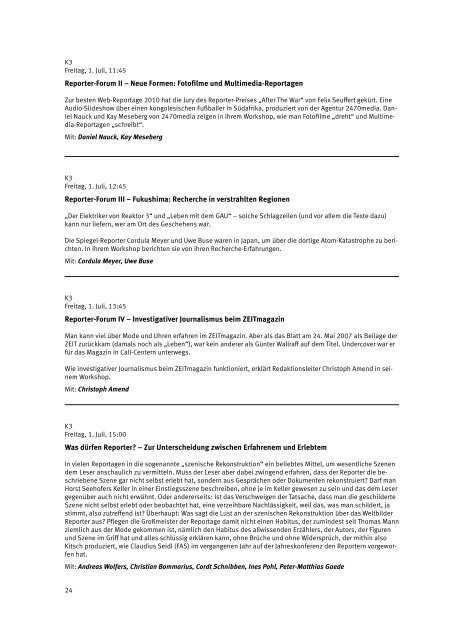
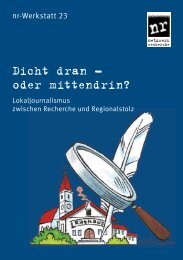
![Kurzbiografien der Referenten und ihre Themen [PDF] - Netzwerk ...](https://img.yumpu.com/21354886/1/184x260/kurzbiografien-der-referenten-und-ihre-themen-pdf-netzwerk-.jpg?quality=85)

![Rede Frank A. Meyer [PDF] - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/21238543/1/184x260/rede-frank-a-meyer-pdf-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)
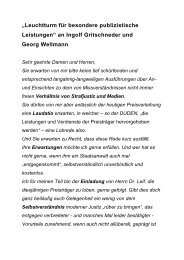




![Die stille Macht [Text] (381 S., 2.142 - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/7467581/1/184x260/die-stille-macht-text-381-s-2142-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)