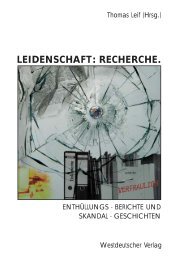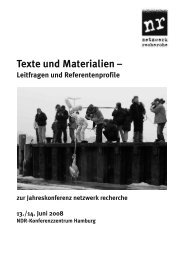Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Themen, Referenten, Materialien - Netzwerk Recherche
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausgleichs mit den Palästinensern – und damit eine Normalisierung der politischen Beziehungen in der<br />
Zukunft möglich ist oder ob sich das Land mit den ihm zur Verfügung stehenden politischen und militärischen<br />
Machtmitteln abschotten und bewusst isolieren sollte. Zunehmend setzt sich die zweite Option als die bessere<br />
Existenzgarantie für Israel in der herrschenden Meinung und damit in den politischen Entscheidungen durch.<br />
Meine Prognose ist, dass der arabische Frühling daran nicht viel ändern wird.<br />
R1<br />
Freitag, 1. Juli, 11:45<br />
China als Exporteur von Zensur-Know-How – Despoten und das Internet<br />
In Kooperation mit journalists.network<br />
Chinas Internetzensur ist kein Unfall der Kommunikationsgeschichte, sondern längst ein Exportmodell. Chinas<br />
Despoten haben schneller als alle Autokraten vor ihnen verstanden, wie sich das Internet nutzen lässt.<br />
Mit: Adrienne Woltersdorf<br />
Leitfragen<br />
Internet, Chinternet oder Chintranet?<br />
Wie schafft es die chinesische Führung 450 Millionen Usern auf die Finger zu schauen?<br />
Was kann ein Internet in einem Big Brother-Staat noch für die Bürger tun?<br />
Was bedeutet die umfassende mediale Zensur für Chinas Blick auf uns?<br />
Und naht mit Chinas weltweiter Medienexpansion ein Kampf der Meinungskulturen?<br />
R1<br />
Freitag, 1. Juli, 12:45<br />
Deutsche Redaktionen – Migrantenfreie Zonen<br />
In Kooperation mit journalists.network<br />
Migranten haben es schon in Spitzenpositionen der deutschen Wirtschaft und Politik geschafft. Aber ausgerechnet<br />
Medien legen intern kaum Wert auf die andere Perspektive, trotz aller Integrationsbeauftragten. Dadurch<br />
werden sie nicht selten zum Wegbereiter des Denkens à la Sarrazin. Was ist faul bei den Medien?<br />
Mit: Cem Sey, Eberhard Seidel<br />
Leitfragen:<br />
Warum gibt es noch immer nur wenige MigrantInnen in den Redaktionen der deutschen Medien, obwohl heute<br />
die vierte Generation von MigrantInnen in die Arbeitswelt drängt?<br />
Ist der Grund dafür Rassismus in deutschen Redaktionsetagen und Personalabteilungen? Oder sind<br />
JournalistInnen nicht deutscher Herkunft einfach weniger objektiv, wenn es um ihre Heimatregionen und die<br />
deutsche Mehrheitsgesellschaft geht?<br />
Aber: Sind deutsche RedakteurInnen tatsächlich so weltoffen, wie sie selbst oft glauben?<br />
Umfragen zeigen: Konkurrenzangst ist es nicht, was deutsche JournalistInnen oft misstrauisch stimmt gegenüber<br />
ihren KollegInnen nicht deutscher Herkunft. Aber was dann?<br />
Wie kommt der deutsche Journalismus in Zeiten Sarrazinesquer Debatten aus der provinziellen Meinungsfalle<br />
heraus? Sind Quoten eine Lösung?<br />
R1<br />
Freitag, 1. Juli, 13:45<br />
Sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache? – Journalisten und Hilfsorganisationen<br />
Hilfsorganisationen und Journalisten gehen häufig Symbiosen ein. Besonders während Krisen, Kriegen, Katas-<br />
trophen sind Journalisten auf Hilfsorganisationen angewiesen. Dabei professionalisiert sich die PR von Hilfsorganisationen<br />
zunehmend, während im Journalismus Stellen und Budgets gekürzt werden. Untergräbt die PR der<br />
„Mitleidsindustrie“ unabhängigen Journalismus?<br />
Mit: Linda Polman, Lutz Mükke, Marion Aberle, Wim Dohrenbusch<br />
Leitfragen:<br />
Wie kompetent informieren Medien über <strong>Themen</strong> der Entwicklungshilfe?<br />
Hilfsorganisationen beschweren sich oft, Journalisten würden erst dann berichten, wenn’s kracht. In Afrika<br />
brauche es schon Hunderttausende, die hungern oder Not leiden, bevor das überhaupt zur Nachricht wird.<br />
Stimmt das? Warum ist das so?<br />
Hilfsorganisationen als auch Journalisten leben zu einem guten Teil von Krisen, Kriegen, Katastrophen.<br />
Journalisten sind bei der K-Berichterstattung oft auf Informationen von Hilfsorganisationen angewiesen. Die<br />
Katastrophen-PR von Hilfsorganisationen soll jedoch häufig überzogen sein. Ist das wahr?<br />
Was müssen Journalisten tun, um solchen Übertreibungen nicht auf den Leim zu gehen?<br />
Journalisten wie Maybrit Illner, Ulli Wickert oder Anne Will und viele andere engagieren sich für<br />
Hilfsorganisationen. Lassen sich Journalisten gern humanitär embedden? Gehen davon Gefahren aus? Und wenn<br />
ja, welche?<br />
Frau Polman hat ihr Buch „Die Mitleidsindustrie“ genannt. Sie zeigt darin, dass Hilfsorganisationen mehr als nur<br />
barmherzigen Motiven folgen. In Afghanistan seien sie bspw. strategischer Teil der Kriegsführung des Westens.<br />
Warum kommen solche Dinge in den Medien kaum zur Sprache?<br />
--<br />
WIM DOHRENBUSCH, WDR-Korrespondent<br />
Wie kompetent informieren Medien über <strong>Themen</strong> der Entwicklungshilfe?<br />
Ein allgemeingültiges Urteil zu fällen, ist schwer. Aber grundsätzlich überwiegt das Klischee vom „ewigen Hungerund<br />
Katastrophenkontinent“. Entwicklungshilfe hat ein grundsätzlich positives Image, die Helfer tun Gutes, und<br />
es wird eher zu wenig geleistet. Eine kritische Sicht auf Entwicklungshilfe und ihre Auswirkungen ist immer noch<br />
die Ausnahme.<br />
Hilfsorganisationen beschweren sich oft, Journalisten würden erst dann berichten, wenn’s kracht. In Afrika<br />
brauche es schon Hunderttausende, die hungern oder Not leiden, bevor das überhaupt zur Nachricht wird.<br />
Stimmt das? Warum ist das so?<br />
Es ist sicher richtig, dass die Aufmerksamkeitsschwelle bei Krisen, Unglücken oder Naturkatastrophen in Afrika<br />
höher liegt als in Deutschland, Europa oder anderen Teilen der Welt. Das liegt vor allem an der geographischen,<br />
aber auch der emotionalen Entfernung, außerdem an der zunehmenden Konzentration der Medien auf<br />
inländische und eher leichte <strong>Themen</strong>. Ob die Hilfsorganisationen die Messlatte immer richtig ansetzen, daran<br />
darf jedoch ebenso gezweifelt werden.<br />
Hilfsorganisationen als auch Journalisten leben zu einem guten Teil von Krisen, Kriegen, Katastrophen.<br />
Journalisten sind bei der K-Berichterstattung oft auf Informationen von Hilfsorganisationen angewiesen. Die<br />
Katastrophen-PR von Hilfsorganisationen soll jedoch häufig überzogen sein. Ist das wahr?<br />
Dafür gibt es durchaus Beispiele. Die großen Hilfsorganisationen betreiben längst sehr professionelle PR und<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Die Konkurrenz der Helfer ist heute so groß, dass „Fundraising“ zum wichtigsten Standbein<br />
geworden ist („jeder Spenden-Euro kann nur einmal ausgegeben werden“). Darüber beklagen sich – hinter<br />
vorgehaltener Hand – auch NGO-Mitarbeiter vor Ort.<br />
Was müssen Journalisten tun, um solchen Übertreibungen nicht auf den Leim zu gehen?<br />
Ihren Job machen, so wie sie ihn hoffentlich gelernt haben. Gründlich recherchieren, Distanz halten und auch die<br />
gegen Klischees in den Heimatredaktion arbeiten. Wenn Journalisten der PR von Hilfsorganisationen nur halb so<br />
kritisch gegenüberstehen würden wie der von Wirtschaftsunternehmen wäre schon viel erreicht.<br />
Journalisten wie Maybrit Illner, Ulli Wickert oder Anne Will und viele andere engagieren sich für<br />
Hilfsorganisationen. Lassen sich Journalisten gern humanitär embedden? Gehen davon Gefahren aus? Und wenn<br />
ja, welche?<br />
Ja. Denn es handelt sich ja immer um prominente Kolleginnen und Kollegen, deren öffentliches Wort großes<br />
Gewicht hat, aber deren Fachkompetenz – natürlich – dahinter zurück bleibt. Wie auch bei Schauspielern,<br />
Musikern oder anderen „Zugpferden“ werden dann in einer oft seltsamen Eigendynamik Not und Elend<br />
fernsehgerecht in Form von Spenden-Galas inszeniert. Aber auch andere Journalisten lassen sich<br />
instrumentalisieren, weil sie Informationen und oft auch logistische Unterstützung der Hilfsorganisationen<br />
brauchen.<br />
Frau Polman hat ihr Buch „Die Mitleidsindustrie“ genannt. Sie zeigt darin, dass Hilfsorganisationen mehr als nur<br />
barmherzigen Motiven folgen. In Afghanistan seien sie bspw. strategischer Teil der Kriegsführung des Westens.<br />
52 53


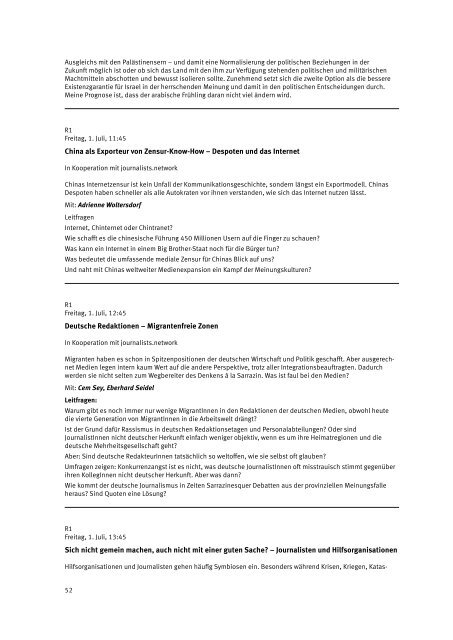
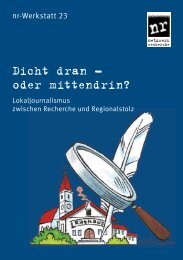
![Kurzbiografien der Referenten und ihre Themen [PDF] - Netzwerk ...](https://img.yumpu.com/21354886/1/184x260/kurzbiografien-der-referenten-und-ihre-themen-pdf-netzwerk-.jpg?quality=85)

![Rede Frank A. Meyer [PDF] - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/21238543/1/184x260/rede-frank-a-meyer-pdf-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)
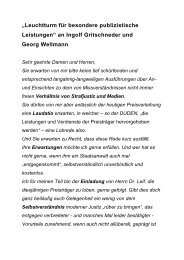




![Die stille Macht [Text] (381 S., 2.142 - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/7467581/1/184x260/die-stille-macht-text-381-s-2142-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)