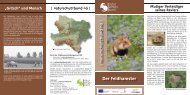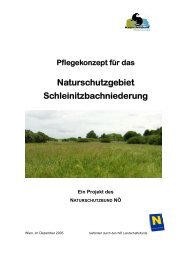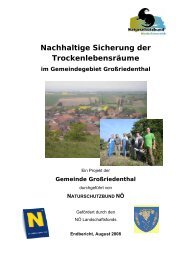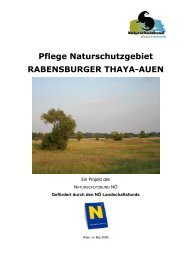Wiesen im Wienerwald - Naturschutzbund NÖ
Wiesen im Wienerwald - Naturschutzbund NÖ
Wiesen im Wienerwald - Naturschutzbund NÖ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
NATURSCHUTZBUND <strong>NÖ</strong> ÖBf-<strong>Wiesen</strong> <strong>im</strong> <strong>Wienerwald</strong><br />
Feuchtwiese ist <strong>im</strong> Hangbereich wüchsiger als am Hangfuß. In der Mitte der Wiese liegt eine nicht sehr große<br />
Anfütterungsstelle (Rübenreste). Insgesamt konnten mehr als 110 <strong>Wiesen</strong>-Pflanzenarten (davon sind 10 österreichweit<br />
gefährdet) <strong>im</strong> Mai 2007 gefunden werden. Damit steht diese Fläche an der 5. Stelle aller <strong>im</strong> Jahre 2007<br />
kartierten ÖBf-<strong>Wiesen</strong>! Die Wiese dürfte in Teilbereichen (steilere Stellen) nicht jährlich gemäht werden. Die<br />
Mahdhäufigkeit ist abzuklären. Solange die Anfütterungsstelle nicht verlagert wird oder größer wird, besteht kein<br />
Problem mit der Erhaltung der Wiese.<br />
50101 Balberwiese<br />
Die Balberwiese ist eine hochinteressante Feuchtwiese mit einem großen Orchideenbestand (Dactylorhiza majalis<br />
x incarnata und maculata: mehr als 1000 blühende Individuen!) und vielen gefährdeten Arten. Diese Wiese dürfte<br />
vielleicht noch nie einen Dünger gesehen haben. Derzeit wird sie zwar gemäht, aber die Rundballen werden nicht<br />
genutzt und randlich abgelagert. Obwohl die Wiese voller Nässe- und Feuchtezeiger ist, war sie am 28.5.2007<br />
ganz trocken. Etwa 15% der Wiese (außerhalb des Polygons <strong>im</strong> Südwesten) werden nicht mehr gemäht und dieser<br />
Teil verbracht gerade, einzelne Gehölze kommen auf. Folgende 11 österreichweit gefährdete Pflanzenarten<br />
wurden in z.T. großen Beständen gefunden: Fleischfarbenes Knabenkraut, Floh-Segge, Saum-Segge, Filz-Segge,<br />
Weiden-Alant, Knäuel-Glockenblume, Niedrige Schwarzwurzel, Sumpf-Blaugras, <strong>Wiesen</strong>-Silge, Knollen-Mädesüß,<br />
Pannonische Platterbse.<br />
Revier Breitenfurt<br />
7800 Deputatwiese<br />
Mehrere ausgedehnte Feuchtwiesenbereiche (Pfeifengraswiesen und Kleinseggenflachmoor) in einer trockenen<br />
bis frischen Trespen-Glatthaferwiese. Großer Artenreichtum mit 107 Pflanzenarten, davon 11 österreichweit gefährdetet,<br />
wie beispielswiese Pannonische Platterbse, Spargelklee, Krautiger Backenklee, Knäuel-Glockenblume,<br />
Knötchen-S<strong>im</strong>se und Lücken-Segge. An den Feuchtbereichen sehr dominantes Auftreten des Weißen Germers.<br />
Wachtelkönig-Vorkommen!<br />
11301 und 11302 Klosterwiese<br />
Großer und sehr vielfältiger <strong>Wiesen</strong>komplex mit Bachdistelwiesen, Pfeifengraswiesen, wechselfeuchten bis frischen<br />
Glatthaferwiesen, sowie nur kleinflächig auftretenden wärmegetönten bis frischen Magerwiesen <strong>im</strong> Oberhang.<br />
Weiteres sehr wesentliches Element sind Kleinseggen-Bachdistelwiesen <strong>im</strong> Bereich von Hangwasseraustritten,<br />
die teils “typischen“ Davallseggenriedern entsprechen, vielfach aber auch von Binsen dominiert werden<br />
(wahrscheinlich nutzungsbedingt). An Naßgallen <strong>im</strong> Oberhang finden sich auch kleine “Waldbinsensümpfe“. Die<br />
Flachmoore liegen in Teilen leider brach oder werden nur mehr unregelmäßig gemäht, daneben sind sie stellenweise<br />
durch Befahren mit schwerem Gerät in Mitleidenschaft gezogen. Die <strong>Wiesen</strong> sind außerordentlich artenreich<br />
und auch zoologisch höchst bedeutsam (z.B. Wanstschrecke, evtl. <strong>Wiesen</strong>knopfbläulinge, Gelbbauchunke,<br />
etc.). Daneben ist das Gebiet als potentieller Lebensraum des Wachtelkönigs anzusehen.<br />
23700 Bäumchenwiese<br />
Die Bäumchenwiese ist Teil des großen <strong>Wiesen</strong>gebiets von Großhöniggraben, welches unter anderem als Lebensraum<br />
des Wachtelkönigs bekannt ist. Es handelt sich um einen artenreichen <strong>Wiesen</strong>komplex (70 Pflanzenarten<br />
wurden erhoben, davon 9 österreichweit gefährdet) der von Bachdistelwiesen beherrscht wird. An trockeneren<br />
Standorten (Oberhang, Geländerücken) gehen diese in wechseltrockene Trespenwiesen (<strong>im</strong> Übergang zur<br />
Trespen-Glatthaferwiese) und “typische“ Trespenwiesen (nur kleinflächig) über. Leider wird bzw. wurde die Wiese<br />
- wenn auch nur sehr zurückhaltend - gedüngt, wodurch in Teilen der Fläche die Arten der Wirtschaftswiesen<br />
gegenüber den Magerkeitszeigern eine gewisse Förderung erfahren haben.<br />
60901 und 60902 Emmelwiese<br />
Ausgedehnte und reich strukturierte Hutweide an der südexponierten Hangflanke des Kaltenleutgebener Grabens.<br />
Die Weidefläche wird über weite Strecken von ausgesprochen artenreichen (Halb)trockenrasen eingenommen, die<br />
eine Vielzahl seltener und bedrohter Arten beherbergen. Als Beispiele seien nur Küchenschelle, Geflecktes Ferkelkraut,<br />
Pannonische Kratzdistel oder Großes Kreuzblümchen genannt. An den Randbereichen gehen die Rasen<br />
in zumeist alte Eichen-Weidewälder über. Einzig entlang der Ostgrenze ist der Wald erst in den letzten Jahrzehnten<br />
aufgewachsen, womit ein Bogen zur Gefährdung der Halbtrockenrasen geschlagen sei. Aufgrund fortwährender<br />
Unterbeweidung und fehlender Weidepflege sind speziell in den steileren Unterhangbereichen flächige Gebüsche<br />
aufgewachsen. Sie sind zumindest in Teilen noch von Viehpfaden und kleinen Rasenflächen durchsetzt,<br />
vielfach wurde die Weidevegetation aber bereits vollständig verdrängt. Durch die zunehmende Verbuschung und<br />
Verwaldung sind langfristig gerade einige der botanisch wertvollsten Flächenteile bedroht (z.B. Standorte der<br />
Küchenschelle). Die Bewirtschaftung der Fläche ist zwar weiterhin gewährleistet (ÖPUL), eine stärkere Bestoßung<br />
ist aber kaum zu erwarten (und auch nur bedingt zu empfehlen). Durch gezielte Pflegemaßnahmen ließe sich der<br />
Zustand der Hutweide aber stabilisieren bzw. verbessern (Entbuschungen, Waldrandpflege, Auslichten der jungen<br />
Weidewälder, etc.). Die Ausarbeitung eines naturschutzfachlichen Pflegekonzepts wäre in diesem singulären Fall<br />
Seite 129