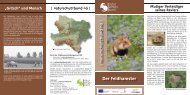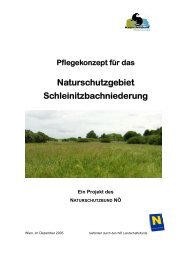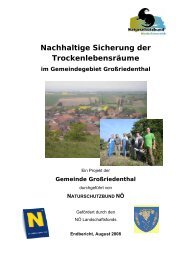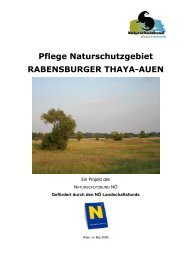Wiesen im Wienerwald - Naturschutzbund NÖ
Wiesen im Wienerwald - Naturschutzbund NÖ
Wiesen im Wienerwald - Naturschutzbund NÖ
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
NATURSCHUTZBUND <strong>NÖ</strong> ÖBf-<strong>Wiesen</strong> <strong>im</strong> <strong>Wienerwald</strong><br />
<strong>Wienerwald</strong>“ bringen ihnen <strong>im</strong> Ökopunktesystem ihre “Gutpunkte“, ihre Intensivflächen haben sie woanders<br />
(z.B. in der Gegend von Alland und Mayerling). Die Ökopunkte-Flächen können prinzipiell als<br />
gesichert gelten, punktuelle Probleme werden mit den Landwirten (z.B. Klärung wg. Mahdterminen,<br />
pfleglicher Umgang mit Feuchtstellen) bzw. den Revierleitern besprochen (z.B. Stabilisierung Waldränder).“<br />
(mündl. Mitteilung).<br />
Jagdpacht-Flächen: Bei Gesprächen mit Landwirten die Flächen bewirtschaften, die sie nur „indirekt“<br />
über einen Jagd-Pächter zur Bewirtschaftung überlassen bekommen, wurde festgestellt, dass für diese<br />
Flächen eher sehr selten Naturschutz-Förderungen beantragt werden. Dadurch ist die Gefahr einer<br />
völligen Nutzungsaufgabe dieser meist abgelegenen Flächen generell größer. Der Grundtenor war<br />
laut Mag. Andreas Beiser folgender:<br />
1.) Der Landwirt mag sich nicht an die Fläche binden, da etwa der Anfahrtsweg sehr weit ist und natürlich<br />
eine Kosten-Nutzen-Rechnung gestellt wird (Verhältnis Ertrag und Bewirtschaftungsaufwand).<br />
Die zu lukrierenden Förderungen durch ÖPUL-WFR bieten nur bedingt einen Anreiz.<br />
2.) Der Landwirt mag sich nicht an die Flächen binden, da es teils konträre Interessen bei der jagdlichen<br />
und landwirtschaftlichen Nutzung gibt: Die Beeinträchtigungen der <strong>Wiesen</strong> durch die jagdliche<br />
Nutzung können die Motivation der Landwirte verringern, diese zu bewirtschaften. Abgesehen von den<br />
Wildschäden wird die Bewirtschaftung durch Hindernisse wie Kirrstellen und dergleichen erschwert,<br />
Probleme kann auch das Wechseln des Standorts von Wildäckern in großen <strong>Wiesen</strong> machen, es bleiben<br />
auf der zur Wiese regenerierenden “Altackerstelle“ Steine zurück (Schäden am Mähwerk können<br />
auftreten).<br />
3.) Die fehlende Sicherheit für den Landwirt, die Flächen auch bis 2013 bewirtschaften zu können.<br />
Waldrandproblematik: Für die Landwirte ergibt sich aus den Waldrändern, die sukzessive in die<br />
Fläche einwachsen mehrere Probleme: durch die kleiner werdenden Flächen, die starke Beschattung<br />
und den Laubeintrag vermindert sich der Ertrag (qualitativ und quantitativ). Außerdem kam es in der<br />
Vergangenheit fördertechnisch gesehen zu großen Problemen, da es bei Unterschreitung der Flächengrößen<br />
zu Rückzahlungsforderungen seitens der AMA kam. Die Gefahr ist hier ebenfalls die Aufgabe<br />
der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Flächen.<br />
Wildschäden: Vier Landwirte äußerten in den Telefonaten, große Probleme mit Wildschäden zu habe.<br />
Rückeschäden: Weitere Probleme bei der <strong>Wiesen</strong>bewirtschaftung bemerken einzelne Landwirte<br />
durch den Holzeinschlag: Rückeschäden, Holz- oder Astmaterial auf den Flächen, das häufige Befahren<br />
mit Maschinen der ÖBf und die Unbefahrbarkeit von Zufahrtswegen wurden dabei erwähnt. Dies<br />
ist für manche ebenfalls ein Grund, sich nicht über Vertragsnaturschutzmaßnahmen wie WFR an Flächen<br />
zu binden.<br />
Ausstieg aus WFR: in einzelnen Fällen gab es auch Landwirte, die zwar bisher Naturschutzförderungen<br />
bezogen haben (ÖPUL 2000), aber aus unterschiedlichen Gründen (Unsicherheit, ob die Bewirtschaftung<br />
bis 2013 aufrecht zu erhalten ist, Angst vor Kontrollen und Rückzahlungen, innerbetriebliche<br />
Notwendigkeit der Intensivierung der Flächen) nicht ins neue ÖPUL 2007 umsteigen wollen.<br />
Herbstzeitlosenproblematik: einige Landwirte haben <strong>im</strong> Vorfeld der Erhebungen als Reaktion auf<br />
den Informationsbrief über das Projekt auch die Problematik von Herbstzeitlosen als Giftpflanzen angesprochen.<br />
Bereits ÖPUL-WF: da die Rücklaufquote der ausgeschickten Fragebögen nur bei 20% lag, wurden<br />
auch Landwirte kontaktiert, auf deren Flächen bereits über WFR finanzierte Vertragsnaturschutzmaßnahmen<br />
stattfinden.<br />
Seite 89