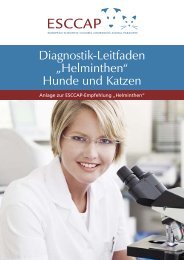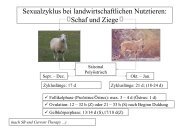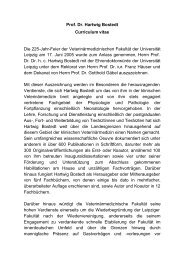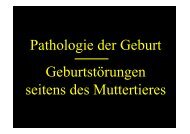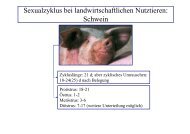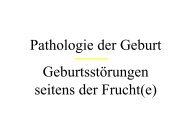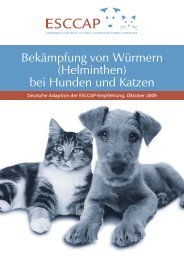Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
LITERATURÜBERSICHT<br />
2 LITERATURÜBERSICHT<br />
2.1 Unfruchtbarkeit beim Milchrind<br />
2.1.1 Allgemeine Betrachtung<br />
Mit stetiger Zunahme der Milchleistung hat die Fruchtbarkeit beim Milchrind in den letzten Jahrzehnten<br />
dramatisch abgenommen (LEROY u. DE KRUIF 2006, OPSOMER et al. 2006). Für die<br />
Milchviehhaltung hat dies bedeutende wirtschaftliche Folgen: erhöhter Besamungsaufwand, verlängerte<br />
Zwischenkalbezeiten, sinkende Erlöse aus dem Kälberverkauf und vermehrte Abgänge wegen<br />
Unfruchtbarkeit sind u.a. Ursachen der wirtschaftlichen Verluste, die bei einer Herdengröße von<br />
100 Milchkühen etwa 5000 € jährlich betragen (LEROY u. DE KRUIF 2006), wobei der Einfluss<br />
verlängerter Zwischenkalbezeiten auf die Wirtschaftlichkeit eines Milchviehbetriebs in der Literatur<br />
kontrovers diskutiert wird (LEROY u. DE KRUIF 2006, LARSSON u. BERGLUND 2000).<br />
2.1.2 Die Fertilität beeinflussende Faktoren<br />
Fruchtbarkeit und Fortpflanzung werden von vielen Faktoren beeinflusst. LEROY u. DE KRUIF<br />
(2006) zufolge ist das „Syndrom Subfertilität“ beim hochleistenden Milchrind im Wesentlichen auf<br />
zwei Schwerpunkte zurückzuführen: zum einen auf die durch eine stark ausgeprägte negative Energiebilanz<br />
in den ersten Wochen nach der Kalbung häufig gestörte Ovarfunktion (OPSOMER et al.<br />
2004), zum anderen auf den hohen Anteil an embryonalem Fruchttod und Resorption in der<br />
Frühgravidität, was möglicherweise auf Veränderungen von Eileiter und / oder Uterus zurückzuführen<br />
ist (LEROYu. DE KRUIF 2006). Abgesehen davon spielen Faktoren wie allgemeine Gesundheit,<br />
Haltung, Klima und Lichtregime (HANZEN et al. 1999, RAAB 2004), Milchleistung<br />
(GRÖHN u. RAJALA-SCHULTZ 2000), Fütterung (STAUFENBIEL et al. 1993), optimale Versorgung<br />
mit Spurenelementen (WILDE 2006), ein gut geführtes Management (v.a. Brunsterkennung,<br />
Besamungszeitpunkt, Puerperalkontrolle) (KINSEL u. ETHERINGTON 1998, DRILLICH et<br />
al. 2002, SHELDON et al. 2006b), Kalbeverlauf, Verlauf des Puerperiums (MOSS et al. 2002),<br />
Kontrolle von Infektionskrankheiten (VANROOSE 2000, GIVENS 2006) und andere eine bedeutende<br />
fertilitätsrelevante Rolle.<br />
2.2 Morphologische Aspekte zum Genitaltrakt des weiblichen Rindes<br />
2.2.1 Ovar<br />
2.2.1.1 Morphologie<br />
Der Eierstock des Rindes ist von ovaler, seitlich abgeplatteter Form. Die Größe des Ovars beträgt<br />
etwa 40 x 20 x 10-20 mm, unterliegt jedoch in Abhängigkeit von den vorhandenen Funktionskörpern<br />
starken Schwankungen (LEISER 2004). Das Organ ist weitgehend von Keimdrüsenepithel, im<br />
Bereich des Margo mesovaricus von Serosa bedeckt und liegt in der Bursa ovarica, die aus dem<br />
Mesovar und der Mesosalpinx gebildet wird (LEISER 2004). Es gliedert sich in die Rindenzone<br />
(Zona parenchymatosa), in der es im Zyklusverlauf zur An- und Rückbildung von Follikeln und<br />
Gelbkörpern kommt, sowie in die gefäßreiche Markzone (Zona vasculosa) (LEISER 2004,<br />
MCENTEE 1990). In Hilusnähe ist - in Homologie zum Rete testis - das Rete ovarii in Form eines<br />
epithelausgekleideten Kanallabyrinths ausgebildet (SMOLLICH 1992).<br />
2