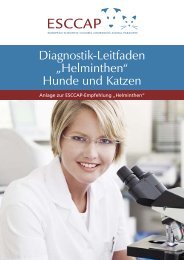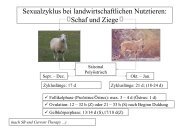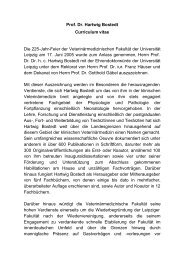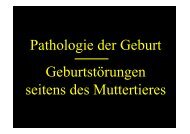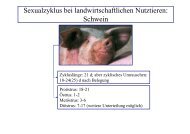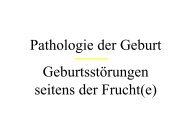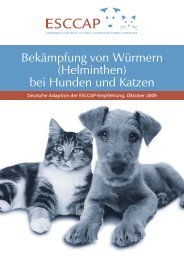Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LITERATURÜBERSICHT<br />
norm vergrößert. Das Allgemeinbefinden ist jedoch ungestört, der (äußerlich oder mittels Vaginoskopie<br />
nachweisbare) uterine Ausfluss ist purulent. Auch die klinische Metritis tritt definitionsgemäß<br />
nur bis zum 21. Tag post partum auf. Als klinische Endometritis bezeichnen SHELDON et<br />
al. (2006a) einen (äußerlich oder vaginoskopisch sichtbaren) purulenten Ausfluss ab dem 21. Tag<br />
sowie einen mukopurulenten Ausfluss bis zum 26. Tag post partum. Die subklinische Endometritis<br />
zeigt keine klinisch erfassbaren Symptome und ist durch einen erhöhten Anteil von neutrophilen<br />
Granulozyten (PMN) im zytologischen Präparat gekennzeichnet, der an den Tagen 21 bis 33 post<br />
partum 18%, an den Tagen 34 -47 post partum 10% übersteigt. Eine Pyometra liegt vor, wenn sich<br />
bei geschlossener Zervix eitriger Inhalt im Uterus befindet und ein persistierendes Corpus luteum<br />
nachweisbar ist.<br />
GILBERT et al. (2005) verzichten auf klinische Merkmale und definieren die Endometritis ausschließlich<br />
nach zytologischen Kriterien: Bei einem Anteil der PMN im zytologischen Ausstrich<br />
einer Uterusspülprobe am 40.-60. Tag post partum von 5% oder mehr ist die Diagnose einer Endometritis<br />
zu stellen, <strong>ohne</strong> dass deren Charakter näher benannt wird.<br />
LENZ (2004) definiert die subklinische Endometritis anhand sonografischer Merkmale bei fehlender<br />
klinischer Symptomatik. Ist die Breite des Uteruslumens im sonografischen Bild größer als 0,2<br />
cm, so liegt - außerhalb des Östrus - eine subklinische Endometritis vor. Im Östrus sind zusätzlich<br />
die Echogenität und Echostruktur von Uterusinhalt und Endometrium hinzuzuziehen.<br />
MCENTEE (1990) und SCHLAFER u. MILLER (2007) nehmen eine weitgehend übereinstimmende<br />
Einteilung vor. Beide unterscheiden, ähnlich wie DE KRUIF (1999), zwischen einer akuten und<br />
chronischen Endometritis, einer Pyometra und einem Uterusabszess, beziehen dabei allerdings im<br />
Gegensatz zu DE KRUIF (1999) nicht klinische, sondern pathologisch-anatomische und -<br />
histologische Kriterien ein:<br />
Bei der akuten Endometritis findet sich ein schokoladenfarbenes bis schmutzig-graues, stinkendes<br />
Exsudat im Uterus. Histologisch ist eine „Leukozyteninfiltration“ (SCHLAFER u. MILLER 2007)<br />
bzw. eine Infiltration mit neutrophilen Granulozyten (MCENTEE 1990) insbesondere im Bereich<br />
des Stratum compactum und des Oberflächenepithels zu beobachten. Im von MCENTEE (1990)<br />
beschriebenen subakuten Stadium kommt es zusätzlich zu einer Infiltration mit Lymphozyten,<br />
Makrophagen und Plasmazellen; neutrophile Granulozyten finden sich dann auch innerhalb der<br />
Uterindrüsenlumina. Bei Vorliegen einer chronischen Endometritis beschreibt MCENTEE (1990)<br />
das Auftreten von Lymphfollikeln. SCHLAFER u. MILLER (2007) führen als Merkmale der chronischen<br />
Endometritis eine lymphoplasmazelluläre Infiltration, eine produktive, teils periglanduläre<br />
Fibrose, Atrophie des Drüsenepithels, Zystenbildung der Uterindrüsen und, in Abhängigkeit vom<br />
Ausmaß der Destruktion, die Ausbildung von Granulations- bzw. Narbengewebe an. Wenn Exsudat<br />
vorhanden ist, kann dieses serös, mukös oder eitrig sein (SCHLAFER u. MILLER 2007). Die Pyometra<br />
zeichnet sich durch eine intrauterine Ansammlung eitrigen Exsudats aus und wird nach<br />
MCENTEE (1990) auch als „postpartale Pyometra“ benannt. Uterine Abszesse sind seltene, fokal<br />
oder multifokal auftretende Prozesse (MCENTEE 1990, SCHLAFER u. MILLER 2007).<br />
SCHULZ (1991) teilt die Endometritis ebenfalls nach pathologisch-anatomischen und -histologischen<br />
Kriterien ein. Er unterscheidet jedoch im Gegensatz zu MCENTEE (1990) und<br />
SCHLAFER u. MILLER (2007) prinzipiell zwischen einer eitrigen und einer nichteitrigen Endometritis,<br />
wobei er die eitrige Endometritis in vier Grade unterteilt: Die eitrige Endometritis 1. Grades<br />
(auch „katarrhalische Endometritis“) kann akut bis chronisch sein und zeichnet sich durch Hyperämie<br />
und Ödematisierung des Endometriums, vermehrte Schleimproduktion sowie eine geringgradige<br />
Infiltration mit Granulozyten, vereinzelt auch mit Lymphozyten und Plasmazellen, aus.<br />
14