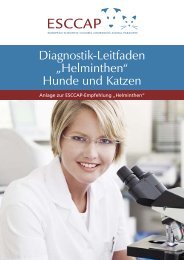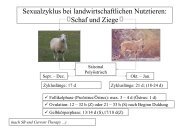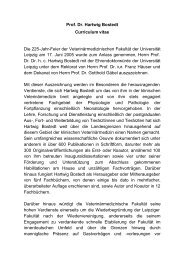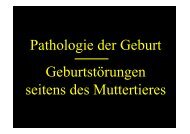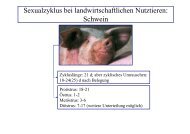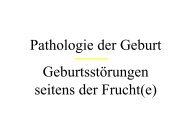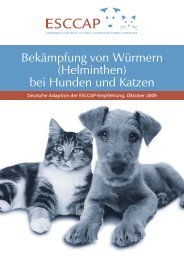Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2.3.4 Veränderungen der Zervix<br />
2.3.4.1 Zervizitis<br />
LITERATURÜBERSICHT<br />
Eine Entzündung der Zervix tritt nach MCENTEE (1990) nicht allein, sondern im Zusammenhang<br />
mit einer Endometritis oder Vaginitis auf. Im Gegensatz dazu beschreiben GLOOR (1973) und<br />
SCHULT (2009) zahlreiche Fälle von Zervizitiden <strong>ohne</strong> andere entzündliche Veränderung des Genitaltraktes.<br />
2.3.4.2 Neoplasien<br />
Neoplasien der Zervix sind beim Rind selten (KENNEDY et al. 1998). Das Leiomyom ist der häufigste<br />
Tumor der Zervix; daneben treten das Fibrom gelegentlich sowie das Adenokarzinom und<br />
Plattenepithelkarzinom sehr selten auf (MCENTEE 1990).<br />
2.4 Weiterführende Methoden zur Diagnostik endometrialer Veränderungen<br />
beim Rind<br />
Über die äußere gynäkologische, rektale, vaginale und vaginoskopische Untersuchung hinaus stehen<br />
in der Buiatrik zahlreiche weiterführende Untersuchungen zur Diagnostik endometrialer Veränderungen<br />
zur Verfügung, die die vorgenannten nicht ersetzen, aber in vielen Fällen sinnvoll ergänzen<br />
können, insbesondere um subklinische Erkrankungen festzustellen (GRUNERT 1999).<br />
2.4.1 Sonografische Untersuchung<br />
Mittels der Sonografie ist es möglich, die Verhältnisse im Uterus bildlich darzustellen. Anhand von<br />
Echogenität und Echostruktur können das Endometrium sowie eventuell im Uterus vorhandener<br />
Inhalt beurteilt werden. Das Verfahren ist nicht-invasiv und frei von Nebenwirkungen (LENZ<br />
2004). Eine Endometritis nicht-exsudativen Charakters ist sonografisch nur schwer oder gar nicht<br />
zu erkennen (GRUNERT 1999).<br />
2.4.2 Zytologie<br />
Die Uteruszytologie wird zur Diagnostik einer eitrigen, subklinischen Endometritis herangezogen.<br />
Dazu kann mittels Uterusspülprobe (GRUNERT 1999, GILBERT et al. 2005, BARLUND et al.<br />
2008) oder mittels Cytobrush (KASIMANICKAM et al. 2004, RAAB 2004, SENOSY et al. 2009)<br />
gewonnenes Material genutzt werden, das auf einem Objektträger ausgestrichen wird. Dann erfolgt<br />
eine zytologische Bestimmung des Anteils neutrophiler Granulozyten (PMN) an der Gesamtzellzahl.<br />
Zur Interpretation der Werte finden sich in der Literatur unterschiedliche Angaben:<br />
KASIMANICKAM et al. (2004) und SHELDON et al. (2006a) nutzen, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt<br />
der Untersuchung, unterschiedliche Grenzwerte: zwischen dem 21. und 33. Tag post partum<br />
liegt nach ihrer Definition eine subklinische Endometritis vor, wenn der Anteil an PMN 18% übersteigt,<br />
für den 34. bis 47. Tag post partum gilt ein Grenzwert von 10%. GILBERT et al. (2005) und<br />
RAAB (2004) definieren als Grenzwert einen Anteil von 5% PMN. Als Grundlage dieser Definitionen<br />
dienen in allen drei Studien Fruchtbarkeitskennzahlen, die im weiteren Verlauf erhoben werden.<br />
Eine Bestätigung der Diagnose „Endometritis“ mittels anderer Verfahren erfolgt in keiner der<br />
Studien. Inwieweit möglicherweise andere Ursachen für mangelnde Fruchtbarkeit als die subklinische<br />
Endometritis vorliegen, ist den Studien nicht zu entnehmen. GRUNERT (1999) schränkt ein,<br />
dass zwar eine exsudative, nicht aber eine chronisch-proliferative Endometritis mittels Zytologie<br />
diagnostiziert werden kann, und dass während des Östrus auch bei Nichtvorliegen einer Endometritis<br />
zytologisch vermehrt PMN nachweisbar sind.<br />
18