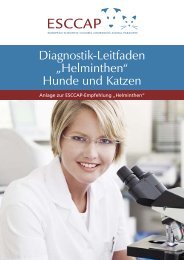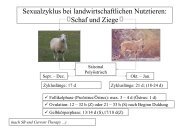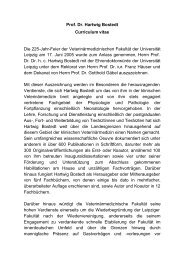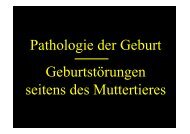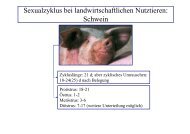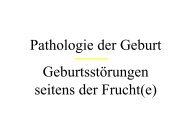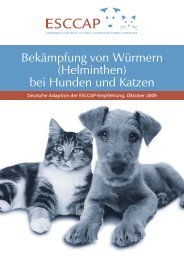Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LITERATURÜBERSICHT<br />
WALTHER (1957) deutet ein vermehrtes Auftreten von Plasmazellen als Anzeichen einer Endometritis.<br />
Mit einem gelb-braunen, grobscholligen Pigment beladene Makrophagen (Siderozyten) sind vor<br />
allem im Stratum compactum nachweisbar (SKJERVEN 1956). SKJERVEN (1956), VAN DEN<br />
HOEK (1959) und COBB u. WATSON (1995) erkennen keine Zyklusabhängigkeit, SCHULZ<br />
(1991) dagegen beschreibt ein vermehrtes Vorkommen im Interöstrus. Sie sind bei Färsen seltener<br />
zu finden als bei Kühen (SKJERVEN 1956). Nach VAN DEN HOEK (1959) beträgt ihre mittlere<br />
Anzahl bis zu 3,3 pro 150x150 µm 2 .<br />
Mastzellen sind im Endometrium des Rindes in allen Zyklusabschnitten in großer Anzahl zu finden<br />
(SKJERVEN 1956, VAN DEN HOEK 1959, SCHMELZER-PERSICKE 1987, MCENTEE 1990,<br />
SCHULZ 1991). Nach WEBER et al. (1950) ist ihre Anzahl zyklusunabhängig. SKJERVEN<br />
(1956), JÜHLING 1959, LIKAR u. LIKAR (1964a) und MCENTEE (1990) beschreiben dagegen<br />
ein im Zyklusverlauf variierendes Vorkommen mit einem Maximum im späten Proöstrus und frühen<br />
Östrus. VAN DEN HOEK (1959) zählt im Mittel während der Follikelphase bis zu 12 Mastzellen,<br />
während der Lutealphase bis zu 27 Mastzellen auf einer Fläche von 150x150 µm 2 . Meist liegen<br />
sie im Stratum compactum (SKJERVEN 1956), häufig in kleinen oder größeren Gruppen, seltener<br />
einzeln (WEBER et al. 1950). Nach LIKAR u. LIKAR (1964b) kommt ihnen möglicherweise eine<br />
Bedeutung im Stoffwechsel saurer Mukopolysaccharide zu.<br />
Oberflächenepithel, Drüsen und Stroma<br />
Das Oberflächenepithel ist einschichtig und überwiegend hochprismatisch mit einer sich im Zyklusverlauf<br />
ändernden Epithelhöhe: nach MCENTEE (1990) wird das im Östrus hochprismatische Epithel<br />
im Postöstrus kubisch, nimmt dann wieder an Höhe zu und erreicht ein Maximum an den Tagen<br />
9 bis 12 des Zyklus. SMOLLICH (1992) beschreibt eine Zunahme der Höhe, ausgehend vom Interöstrus<br />
über den Proöstrus und Östrus bis hin zum Postöstrus, und eine darauffolgende Abnahme der<br />
Epithelhöhe zum Interöstrus. Dabei ist teilweise eine Zwei- und Mehrreihigkeit des Epithels zu<br />
beobachten. Laut SCHULZ (1991) zeigt das Oberflächenepithel im Östrus eine ausgeprägte Sekretion<br />
und stellt sich im Interöstrus flachzylindrisch, teilweise kubisch dar. In der von SCHULZ<br />
(1991) am Ende des Interöstrus beschriebenen Ruhephase ist das Oberflächenepithel inaktiv, bis es<br />
im Proöstrus wieder eine beginnende Sekretion sowie vereinzelte Mitosen aufweist.<br />
Die Uterindrüsen sind verzweigte, tubuläre Drüsen, die in der Tiefe zyklusabhängig unterschiedlich<br />
stark gewunden, zur Oberfläche dagegen überwiegend gestreckt sind (SKJERVEN 1956,<br />
MCENTEE 1990, SMOLLICH 1992). Nach MCENTEE (1990) und SMOLLICH (1992) sind die<br />
Drüsen im Östrus weitgehend gestreckt und im Postöstrus maximal aktiv und stark gewunden, während<br />
der Grad der Schlängelung im Interöstrus wieder abnimmt. Das Drüsenepithel ist hochprismatisch,<br />
die maximale Höhe erreichen die Epithelzellen im Postöstrus. Laut SCHULZ (1991) zeigen<br />
die Uterindrüsen im Östrus eine beginnende Sekretion mit Mitosen im Mündungsgebiet der Drüsenschläuche.<br />
Im Interöstrus beobachtet er eine zunehmende Schlängelung der Drüsen, wodurch die<br />
Anzahl der quergeschnittenen Drüsen im histologischen Schnitt zunimmt. Die hochprismatischen<br />
Epithelzellen zeigen im Interöstrus eine maximale Sekretion. In der folgenden Ruhephase wird das<br />
Epithel nach seinen Angaben flachzylindrisch bis kubisch mit dunklen Zellkernen. Im Proöstrus<br />
sind die Uterindrüsen geringgradig aktiv und zeigen eine beginnende Sekretion.<br />
Das Gewebe, in das die Uterindrüsen eingelagert sind, bezeichnet MCENTEE (1990) als Bindegewebe<br />
und die darin vorkommenden Zellen als Fibroblasten, die im Stratum compactum große, blasse<br />
Zellkerne und im Stratum spongiosum kleinere, dunkle Zellkerne aufweisen. SCHULZ (1991)<br />
6