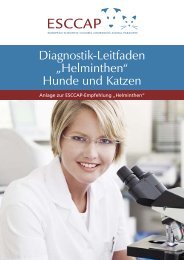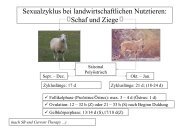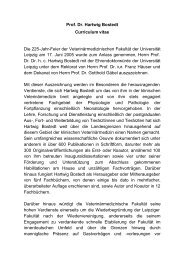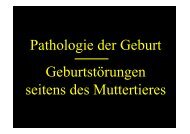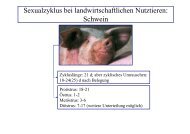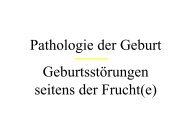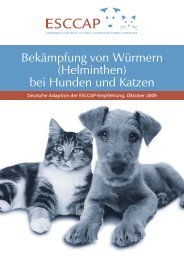Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Dissertation Rodenbusch_20052011 ohne Lebenslauf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4.1.7 Zusammenfassende Betrachtung<br />
ERGEBNISSE<br />
Aufgrund der hochfrequenten Bioptatentnahme liegen in einem Teil der Bioptate reaktive Prozesse<br />
vor. Auch wenn diese Bioptate nicht zur quantitativen Bestimmung der Zellzahl genutzt wurden, ist<br />
ein Einfluss der Bioptatentnahme auf die erhobenen Daten nicht auszuschließen. Die erhobenen<br />
Zellzahlen stellen daher ein möglicherweise leicht verfälschtes Abbild des Normalbefundes der<br />
zyklusabhängigen Infiltration des Endometriums mit freien Zellen im Rahmen der physiologischen<br />
Selbstreinigung dar. Dennoch scheinen sie, auch im Vergleich mit den Ergebnissen von VAN DEN<br />
HOEK (1959), geeignet, als Grundlage für die Definition der Endometritis (vgl. Kap. 3.4.2.3., S.<br />
28) zu dienen. Desweiteren beschreibt dieses Material den Normalbefund der Funktionsmorphologie<br />
endometrialer Strukturen im Zyklusverlauf.<br />
Die stärkste Infiltration mit neutrophilen Granulozyten wird an den Tagen 2 und 20 beobachtet.<br />
Eosinophile Granulozyten treten über den Zyklusverlauf stets nur vereinzelt auf und sind meist in<br />
den oberflächlichen endometrialen Strukturen zu finden. Lymphozyten finden sich vermehrt zum<br />
Zeitpunkt der Ovulation (Tag 0) und an Tag 18. Die Infiltration mit Plasmazellen erreicht am Tag<br />
18 ihr Maximum. Makrophagen treten an den Tagen 0 und 10 im Vergleich zu den übrigen Zyklustagen<br />
tendenziell vermehrt auf. Die Infiltration des Endometriums mit Mastzellen ist zum Zeitpunkt<br />
der Ovulation am höchsten und an Tag 5 am niedrigsten.<br />
4.2 Gruppe B ("Kontrollgruppe“) - Untersuchungsbefunde<br />
4.2.1 Klinische Befunde<br />
Die 15 fertilen Kühe der Kontrollgruppe (Gruppe B) wurden am Tag der Bioptatentnahme durch<br />
Mitarbeiter/-innen der AGTK, Universität Leipzig, klinisch-gynäkologisch untersucht. Die Ergebnisse<br />
sind in Tab. 9.10 (Anhang S. 113) zusammengefasst. Mittels äußerer gynäkologischer und<br />
vaginoskopischer Untersuchung konnten bei keinem Tier auffällige Befunde erhoben werden. Im<br />
Rahmen der rektalen Untersuchung zeigte ein Tier eine Asymmetrie der Uterushörner. Bei der<br />
transrektalen sonografischen Untersuchung wurde bei fünf Tieren intrauterine Flüssigkeit und bei<br />
drei Tieren eine hyperechogene Uterusschleimhaut festgestellt. Alle übrigen Kühe (n=6) stellten<br />
sich klinisch-gynäkologisch unauffällig dar. Im Rahmen der zytologischen Untersuchung der Uterusschleimhaut<br />
mittels Cytobrush wiesen vier Kühe mehr als 5% PMN auf. Bei neun Tieren lag der<br />
Wert unter 5%, in zwei Fällen war das Cytobrush-Präparat aufgrund einer zu geringen Zellzahl<br />
nicht auswertbar. Alle Tiere konnten im Anschluss an die Bioptatentnahme erfolgreich besamt werden<br />
(siehe Tab. 9.11 und 9.12, Anhang S. 113).<br />
4.2.2 Auswertbarkeit des Probenmaterials<br />
Von jedem der 15 Tiere wurden zwei Endometriumbioptate (jeweils eines aus dem linken und dem<br />
rechten Uterushorn in der Nähe der Bifurkation) entnommen, sodass insgesamt 30 Endometriumbioptate<br />
vorlagen (s. Abb. 4.12).<br />
6<br />
24<br />
auswertbar<br />
nicht auswertbar<br />
6<br />
Abb. 4.12: Überblick zur Auswertbarkeit der Endometriumbioptate; links: Gesamtüberblick; rechts:<br />
Bioptate pro Rind<br />
49<br />
9<br />
beide Bioptate auswertbar<br />
eines von zwei Bioptaten auswertbar