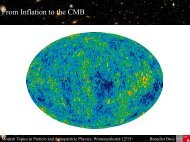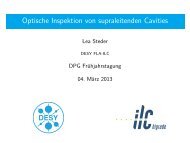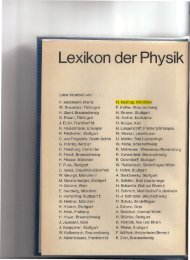BeLL Katrin Kröger endgültig - Desy
BeLL Katrin Kröger endgültig - Desy
BeLL Katrin Kröger endgültig - Desy
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die wichtigsten Experimenttypen sind „Target“ und „Collider“.<br />
Rutherford hat ein typisches Target-Experiment durchgeführt. Seine Geschosse trafen auf ein<br />
ruhendes Ziel, das Target.<br />
Mittlerweile hat sich in den meisten Fällen das Collider-Experiment durchgesetzt, da dadurch die<br />
Energieausbeute besser ist: Das Geschoss und das Target bewegen sich aufeinander zu.<br />
Vergleichbar ist dieser Vorgang mit einem Autozusammenprall 9 . Fährt ein Auto mit voller Wucht<br />
gegen ein ruhendes, so wird dessen Bewegungsenergie zum Teil in die Weiterbewegung der beiden<br />
Autos übertragen und nicht vollständig in die Zerstörung umgesetzt, was bei einem frontalen<br />
Zusammenstoß zweier aufeinander zufahrender Autos hingegen gegeben ist.<br />
Bei Target-Experimenten bewegt sich das gesamte System nach dem Stoß weiter, bei Collider-<br />
Experimenten geht die Energie (fast) vollständig in die eigentliche Kollision hinein.<br />
Je nach Energieaufwand werden entweder nur die Strukturen abgetastet oder die beteiligten<br />
Teilchen werden zerstört, bei letzterem geht ihre Ruhemasse und ihre Bewegungsenergie in die<br />
Erzeugung von neuen Teilchen über. Werden neue instabile Teilchen erzeugt, so werden diese auf<br />
ihre Eigenschaften (z.B Masse und Ladung) untersucht. Die Rekonstruktion dieses Vorganges erlaubt<br />
Aussagen darüber, was genau im Kollisionszentrum passiert ist. Daraus lassen sich<br />
Schlussfolgerungen über z. B. Unterstruktur oder Eigenschaften der kollidierten Teilchen ableiten.<br />
„Mit der Weiterentwicklung der Teilchenbeschleuniger wurden die "Geschosse" […] [energiereicher]<br />
und die Zusammenstöße heftiger. Mit steigender Teilchenenergie sondierten die Streuexperimente<br />
immer kleinere Abstände, sie offenbarten immer feinere Details. 1954 wurde deutlich, dass die<br />
Protonen keinesfalls "Punkte" sind, sondern einen messbaren Durchmesser besitzen; Ende der<br />
1960er Jahre entdeckte man am Beschleunigerzentrum SLAC in Kalifornien die Bausteine der<br />
Protonen und Neutronen, die Quarks. Die Experimente H1 und ZEUS an der Speicherringanlage HERA<br />
[siehe Unterpunkt „DESY“] schreiben die Erfolgsgeschichte der Streuversuche fort. Auch hier prallen<br />
Elektronen auf Protonen, und der Winkel und die Energie der gestreuten Elektronen geben<br />
Aufschluss über die Vorgänge im Proton. Da die Protonen bei den HERA-Experimenten nicht ruhen,<br />
sondern ebenfalls auf hohe Energien beschleunigt werden, ist die Energie, die den Elektronen<br />
während der Kollision zur Verfügung steht, etwa 2600-mal größer als bei dem SLAC-Experiment von<br />
1969 - und 9 000 000-mal höher als die der Alphateilchen von Rutherford. Damit ermöglicht HERA<br />
heute den weltweit schärfsten Blick ins Proton - bis hinunter zu Strukturen, die nur den milliardsten<br />
Teil eines milliardstel Meters groß sind, d.h. 2000-mal kleiner als das Proton selbst.“ 10 Die so zu<br />
untersuchenden Strukturen liegen im Bereich 10 -18 m.<br />
Die gewählte Veranschaulichung der Streuexperimente hat eine Analogie zur tatsächlichen Art der<br />
Erkenntnisgewinnung der Teilchenphysiker: Das Zusammentreffen des jeweilige Geschosses mit dem<br />
Sack ist das, was in den Teilchenbeschleunigern vorbereitet und in der Mitte des Detektors<br />
durchgeführt wird. Die Messung der Kollision nimmt der Detektor vor, er detektiert (=weist nach) die<br />
meisten Teilchen, die in der Kollision gestreut oder auch neu erzeugt werden. Schlussfolgerungen<br />
daraus müssen von den Physikern selbst gezogen werden, normalerweise mithilfe von<br />
Computerprogrammen. Die Analogie: Im Beispiel hat der Geschmackssinn den Geschmack der Nuss<br />
nachgewiesen. Unser Verstand folgert daraus die Existenz von Nüssen.<br />
9 Das hier vorgestellte Modell stammt aus Waloschek (1996): Besuch im Teilchenzoo, S. 88<br />
10 zitiert nach Deutsches Elektronen-Synchrotron: Das Supermikroskop HERA, S.53<br />
11