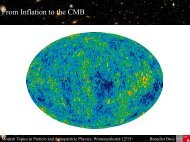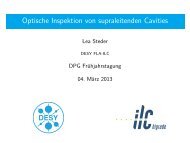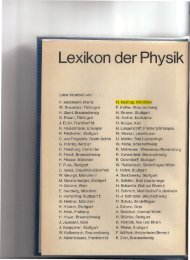BeLL Katrin Kröger endgültig - Desy
BeLL Katrin Kröger endgültig - Desy
BeLL Katrin Kröger endgültig - Desy
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
umfasst, auf die richtigen Bedingungen zu achten, wie z. B. fortdauernde Kühlung, richtige Spannung<br />
und Stromzufuhr, richtige Magnetfeldstärke usw. Auch werden von hier die Injektionen der<br />
Teilchenstrahlen und das Zusammenspiel mit den Vorbeschleunigern koordiniert. Auch die<br />
Datennahme durch die einzelnen Experimente wird von diesen in deren Kontrollräumen rund um die<br />
Uhr überwacht.<br />
3.6.2. Die Messung 34<br />
Was letztendlich gemessen wird, sind in den meisten Fällen Energie- und Winkelverteilungen. An<br />
einem einfachen Beispiel erklärt, sieht dies so aus: Ein Elektron wird auf ein Proton geschossen. Mit<br />
dem Detektor wird gemessen, in welchem Winkel mit welchem Energiebetrag es nach der Kollision<br />
weiterfliegt. Die Werte werden in ein Diagramm eingetragen, dem sogenannten „Plot“, ein. In<br />
diesem Fall ist auf der x-Achse entweder der Winkel oder die Energie aufgetragen, während die y-<br />
Achse die Anzahl der Ereignisse darstellt. Dabei reicht die Messung von einem einzigen Ereignis<br />
natürlich nicht aus. Da sich in diesen Bereichen quantenmechanische Effekte bemerkbar machen,<br />
somit Wahrscheinlichkeiten, muss eine relativ hohe Zahl von Ereignissen ausgewertet werden, damit<br />
die statistische Erfassung aussagekräftig wird. Da, wo sich dann besonders viele Ereignisse einordnen<br />
lassen, ist der sogenannte „Peak“. An dieser Stelle wird es dann interessant. Bereiche, die auch<br />
interessant sind, sind die, in denen man Ereignisse sieht, obwohl man in dem entsprechenden<br />
Bereich keine erwartet hätte (Physik jenseits des Standardmodells).<br />
Wie genau geht eine Physikdatenauswertung vonstatten?<br />
Zunächst werden die vom Detektor kommenden Daten nach bestimmten Parametern selektiert.<br />
Mögliche Parameter sind dabei z. B. Impuls- oder Winkelverteilung. Wie die Parameter gewählt<br />
werden, muss sich der Physiker vorher meist anhand der Theorie und mit Hilfe von Simulationen<br />
überlegen, denn je nach zu untersuchenden Teilchen bzw. Prozessen sind die zu selektierenden<br />
Variablen anders. Dann wird der sogenannte Untergrund subtrahiert. Zum Untergrund zählen dabei<br />
die schon bekannten und erklärbaren Ereignisse, heute ist dies quasi der Bereich, den das<br />
Standardmodell abdeckt. Häufig wird deswegen auch von der Suche nach „Neuer Physik“<br />
gesprochen, da es eben darum geht, das schon sehr gut bestätigte Standardmodell um neue Inhalte<br />
zu erweitern. Ist das Signal dann durch diese Filtervorgänge bestimmt, so folgt die Fehleranalyse: Bei<br />
der Analyse der systematischen Fehler werden z. B. technische Probleme des Detektors beachtet und<br />
korrigiert, bei der Analyse des statistischen Fehlers werden mathematische Methoden angewendet.<br />
Dann wird untersucht, inwieweit sich das experimentelle Ergebnis von der theoretischen Vorhersage<br />
unterscheidet. Die Theorie macht Vorhersagen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei einer<br />
bestimmten Kollision welche Teilchen erzeugt werden. Daraus ergibt sich eine<br />
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese Modellvorstellung wird mit den gemessenen Daten verglichen.<br />
Daraus können dann neue Erkenntnisse gewonnen werden.<br />
34 zu den Informationen dieses Unterkapitels vgl. Behnke (2009)<br />
54