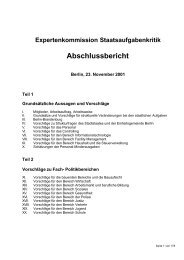Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen ... - Ecologic Institute
Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen ... - Ecologic Institute
Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen ... - Ecologic Institute
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
das Ernährungsgewerbe, das Wasser in Lebensmittelqualität in der Produktion einsetzt<br />
(Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 1998b). Für andere Verwendungszwecke (Produktion, Kühlung)<br />
genügt vielfach der Einsatz von Wasser in Brauchwasserqualität. Zahlen über den<br />
Bezug von Betriebswasser von öffentlichen Versorgungsunternehmen liegen nicht vor.<br />
Multi-Utility-Strategie<br />
Als Multi-Utility-Strategie wird das Angebot unterschiedlicher Ver- <strong>und</strong> Entsorgungsleistungen sowie<br />
damit verb<strong>und</strong>ener Dienstleistungen aus einer Hand bezeichnet (u.a. Strom, Gas, Wärme,<br />
Wasser, Abwasser, Abfall, Telekommunikation, Gebäudemanagement). In der Vergangenheit waren<br />
zahlreiche Stadtwerke als Multi-Utility-Anbieter tätig. Mittlerweile entscheidet sich auch eine<br />
wachsende Anzahl von privaten Unternehmen für diese strategische Option (u.a. Berlinwasser,<br />
RWE). Eingeleitet wurde diese Entwicklung durch eine verstärkte Marktöffnung in der Versorgungs-<br />
<strong>und</strong> Entsorgungswirtschaft. Den privaten Unternehmen erlauben diese <strong>Rahmenbedingungen</strong>,<br />
auch außerhalb ihres angestammten Versorgungsgebietes tätig zu werden <strong>und</strong> sich in neue<br />
Märkte einzukaufen. Auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern entdecken zur Zeit insbesondere<br />
die großen Energieversorger das Wassergeschäft für sich. Multi-Utility erweist sich für die Unternehmen<br />
dann als vorteilhaft, wenn sie aufgr<strong>und</strong> von Synergieeffekten beim Angebot mehrerer<br />
der angeführten Leistungen aus einer Hand Kostenvorteile realisieren können (economies of<br />
scope). Die größten Einsparpotenziale werden bei der Zusammenfassung von Handel <strong>und</strong> Vertrieb<br />
(Ablesung, Abrechnung, K<strong>und</strong>enakquisition, K<strong>und</strong>enbindung, Marketing) vermutet (SCHÜRMANN,<br />
2000). Für die K<strong>und</strong>en kann die Abnahme von Versorgungs- <strong>und</strong> Entsorgungsleistungen aus einer<br />
Hand mit Transaktionskosteneinsparungen verb<strong>und</strong>en sein. Ihre Verhandlungsposition gegenüber<br />
den Anbietern wird gegebenenfalls gestärkt.<br />
Das Verhältnis zwischen Eigengewinnung <strong>und</strong> Wasserbezug sowie zwischen Wasserabgabe<br />
an Endverbraucher <strong>und</strong> Weiterverteiler weist regional große Unterschiede auf.<br />
Während einige Wasserversorgungsunternehmen auf die Eigengewinnung vollständig<br />
verzichten, beziehen andere Versorgungsunternehmen Fernwasser zusätzlich zu dem in<br />
eigenen Anlagen gewonnenen Wasser. 1995 haben öffentliche Wasserversorgungsunternehmen<br />
insgesamt 35 % des Wasseraufkommens von Dritten bezogen. R<strong>und</strong> 6 % des<br />
Fremdbezugs (2 % des Wasseraufkommens) stammten aus der Industrie, der Rest von<br />
anderen öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 1998a).<br />
Die Kosten der Wasserversorgungsunternehmen teilen sich nach einem Betriebsvergleich<br />
von Zweckverbänden <strong>und</strong> Weiterverteilern in Baden-Württemberg grob wie folgt auf die<br />
Teilleistungen der Trinkwasserversorgung auf: Transport, Druckanpassung, Speicherung,<br />
örtliche Verteilung 56 %, Gewinnung, Beschaffung, Aufbereitung 33 % <strong>und</strong> Verwaltungskosten,<br />
sonstige 11 % (MEHLHORN, 2001). Von den Gesamtkosten entfallen 30 bis<br />
35 % auf Personal, 10 bis 15 % auf Energie- <strong>und</strong> Material, 20 bis 25 % auf Abschreibungen,<br />
5 bis 10 % auf Zinsen, 5 bis 20 % auf Steuern <strong>und</strong> Abgaben <strong>und</strong> 10 bis 15 % auf<br />
fremdbezogene Dienstleistungen. Der BGW (schriftl. Mitteilung, 6.10.2000) gibt an, dass<br />
es sich bei 80 bis 90 % Gesamtkosten um Fixkosten handelt, die unabhängig von der<br />
Auslastung der Anlagen anfallen.<br />
Von den Wasserversorgungsunternehmen haben r<strong>und</strong> 75 % das Benutzungsverhältnis<br />
mit den Abnehmern öffentlich-rechtlich ausgestaltet <strong>und</strong> erheben Gebühren <strong>und</strong> Beiträge<br />
nach den Kommunalabgabengesetzen. R<strong>und</strong> 25 % der Unternehmen erheben privatrechtliche<br />
Entgelte. Auf diese entfallen 50 % des Wasserverbrauchs (BGW, schriftl. Mitteilung,<br />
6.10.2000). Die durchschnittlichen Wasserpreise sind zwischen 1992 <strong>und</strong> 2000 von 2,31<br />
13