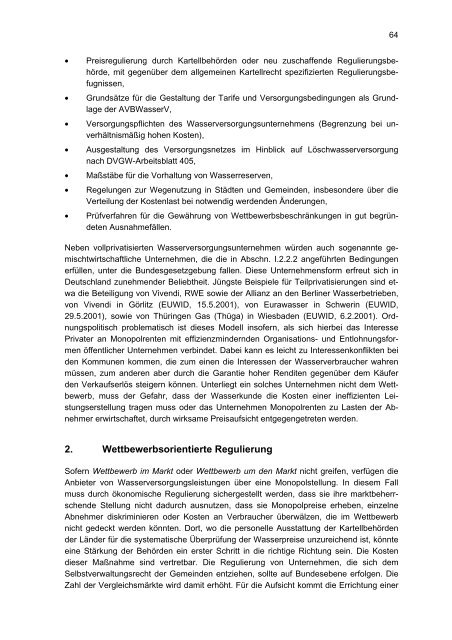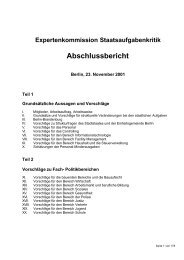Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen ... - Ecologic Institute
Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen ... - Ecologic Institute
Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen ... - Ecologic Institute
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
• Preisregulierung durch Kartellbehörden oder neu zuschaffende Regulierungsbehörde,<br />
mit gegenüber dem allgemeinen Kartellrecht spezifizierten Regulierungsbefugnissen,<br />
• Gr<strong>und</strong>sätze für die Gestaltung der Tarife <strong>und</strong> Versorgungsbedingungen als Gr<strong>und</strong>lage<br />
der AVBWasserV,<br />
• Versorgungspflichten des Wasserversorgungsunternehmens (Begrenzung bei unverhältnismäßig<br />
hohen Kosten),<br />
• Ausgestaltung des Versorgungsnetzes im Hinblick auf Löschwasserversorgung<br />
nach DVGW-Arbeitsblatt 405,<br />
• Maßstäbe für die Vorhaltung von Wasserreserven,<br />
• Regelungen zur Wegenutzung in Städten <strong>und</strong> Gemeinden, insbesondere über die<br />
Verteilung der Kostenlast bei notwendig werdenden Änderungen,<br />
• Prüfverfahren für die Gewährung von Wettbewerbsbeschränkungen in gut begründeten<br />
Ausnahmefällen.<br />
Neben vollprivatisierten Wasserversorgungsunternehmen würden auch sogenannte gemischtwirtschaftliche<br />
Unternehmen, die die in Abschn. I.2.2.2 angeführten Bedingungen<br />
erfüllen, unter die B<strong>und</strong>esgesetzgebung fallen. Diese Unternehmensform erfreut sich in<br />
Deutschland zunehmender Beliebtheit. Jüngste Beispiele für Teilprivatisierungen sind etwa<br />
die Beteiligung von Vivendi, RWE sowie der Allianz an den Berliner Wasserbetrieben,<br />
von Vivendi in Görlitz (EUWID, 15.5.2001), von Eurawasser in Schwerin (EUWID,<br />
29.5.2001), sowie von Thüringen Gas (Thüga) in Wiesbaden (EUWID, 6.2.2001). Ordnungspolitisch<br />
problematisch ist dieses Modell insofern, als sich hierbei das Interesse<br />
Privater an Monopolrenten mit effizienzmindernden Organisations- <strong>und</strong> Entlohnungsformen<br />
öffentlicher Unternehmen verbindet. Dabei kann es leicht zu Interessenkonflikten bei<br />
den Kommunen kommen, die zum einen die Interessen der Wasserverbraucher wahren<br />
müssen, zum anderen aber durch die Garantie hoher Renditen gegenüber dem Käufer<br />
den Verkaufserlös steigern können. Unterliegt ein solches Unternehmen nicht dem Wettbewerb,<br />
muss der Gefahr, dass der Wasserk<strong>und</strong>e die Kosten einer ineffizienten Leistungserstellung<br />
tragen muss oder das Unternehmen Monopolrenten zu Lasten der Abnehmer<br />
erwirtschaftet, durch wirksame Preisaufsicht entgegengetreten werden.<br />
2. Wettbewerbsorientierte Regulierung<br />
Sofern Wettbewerb im Markt oder Wettbewerb um den Markt nicht greifen, verfügen die<br />
Anbieter von Wasserversorgungsleistungen über eine Monopolstellung. In diesem Fall<br />
muss durch ökonomische Regulierung sichergestellt werden, dass sie ihre marktbeherrschende<br />
Stellung nicht dadurch ausnutzen, dass sie Monopolpreise erheben, einzelne<br />
Abnehmer diskriminieren oder Kosten an Verbraucher überwälzen, die im Wettbewerb<br />
nicht gedeckt werden könnten. Dort, wo die personelle Ausstattung der Kartellbehörden<br />
der Länder für die systematische Überprüfung der Wasserpreise unzureichend ist, könnte<br />
eine Stärkung der Behörden ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Die Kosten<br />
dieser Maßnahme sind vertretbar. Die Regulierung von Unternehmen, die sich dem<br />
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden entziehen, sollte auf B<strong>und</strong>esebene erfolgen. Die<br />
Zahl der Vergleichsmärkte wird damit erhöht. Für die Aufsicht kommt die Errichtung einer<br />
64