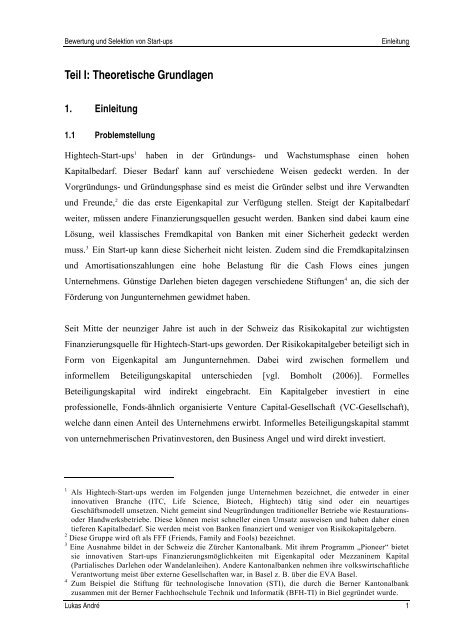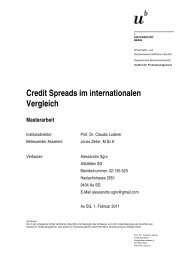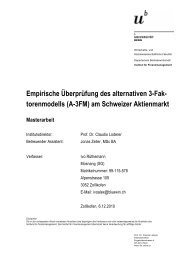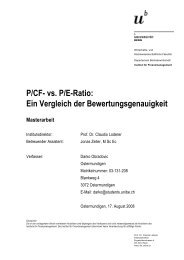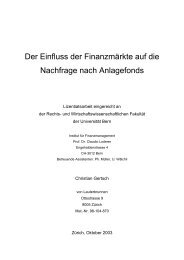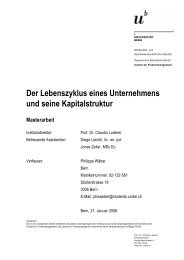Download - Institut für Finanzmanagement - Universität Bern
Download - Institut für Finanzmanagement - Universität Bern
Download - Institut für Finanzmanagement - Universität Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bewertung und Selektion von Start-ups<br />
Einleitung<br />
Teil I: Theoretische Grundlagen<br />
1. Einleitung<br />
1.1 Problemstellung<br />
Hightech-Start-ups 1 haben in der Gründungs- und Wachstumsphase einen hohen<br />
Kapitalbedarf. Dieser Bedarf kann auf verschiedene Weisen gedeckt werden. In der<br />
Vorgründungs- und Gründungsphase sind es meist die Gründer selbst und ihre Verwandten<br />
und Freunde, 2 die das erste Eigenkapital zur Verfügung stellen. Steigt der Kapitalbedarf<br />
weiter, müssen andere Finanzierungsquellen gesucht werden. Banken sind dabei kaum eine<br />
Lösung, weil klassisches Fremdkapital von Banken mit einer Sicherheit gedeckt werden<br />
muss. 3 Ein Start-up kann diese Sicherheit nicht leisten. Zudem sind die Fremdkapitalzinsen<br />
und Amortisationszahlungen eine hohe Belastung <strong>für</strong> die Cash Flows eines jungen<br />
Unternehmens. Günstige Darlehen bieten dagegen verschiedene Stiftungen 4 an, die sich der<br />
Förderung von Jungunternehmen gewidmet haben.<br />
Seit Mitte der neunziger Jahre ist auch in der Schweiz das Risikokapital zur wichtigsten<br />
Finanzierungsquelle <strong>für</strong> Hightech-Start-ups geworden. Der Risikokapitalgeber beteiligt sich in<br />
Form von Eigenkapital am Jungunternehmen. Dabei wird zwischen formellem und<br />
informellem Beteiligungskapital unterschieden [vgl. Bomholt (2006)]. Formelles<br />
Beteiligungskapital wird indirekt eingebracht. Ein Kapitalgeber investiert in eine<br />
professionelle, Fonds-ähnlich organisierte Venture Capital-Gesellschaft (VC-Gesellschaft),<br />
welche dann einen Anteil des Unternehmens erwirbt. Informelles Beteiligungskapital stammt<br />
von unternehmerischen Privatinvestoren, den Business Angel und wird direkt investiert.<br />
1 Als Hightech-Start-ups werden im Folgenden junge Unternehmen bezeichnet, die entweder in einer<br />
innovativen Branche (ITC, Life Science, Biotech, Hightech) tätig sind oder ein neuartiges<br />
Geschäftsmodell umsetzen. Nicht gemeint sind Neugründungen traditioneller Betriebe wie Restaurationsoder<br />
Handwerksbetriebe. Diese können meist schneller einen Umsatz ausweisen und haben daher einen<br />
tieferen Kapitalbedarf. Sie werden meist von Banken finanziert und weniger von Risikokapitalgebern.<br />
2 Diese Gruppe wird oft als FFF (Friends, Family and Fools) bezeichnet.<br />
3 Eine Ausnahme bildet in der Schweiz die Zürcher Kantonalbank. Mit ihrem Programm „Pioneer“ bietet<br />
sie innovativen Start-ups Finanzierungsmöglichkeiten mit Eigenkapital oder Mezzaninem Kapital<br />
(Partialisches Darlehen oder Wandelanleihen). Andere Kantonalbanken nehmen ihre volkswirtschaftliche<br />
Verantwortung meist über externe Gesellschaften war, in Basel z. B. über die EVA Basel.<br />
4 Zum Beispiel die Stiftung <strong>für</strong> technologische Innovation (STI), die durch die <strong>Bern</strong>er Kantonalbank<br />
zusammen mit der <strong>Bern</strong>er Fachhochschule Technik und Informatik (BFH-TI) in Biel gegründet wurde.<br />
Lukas André 1