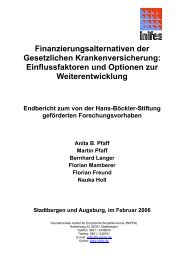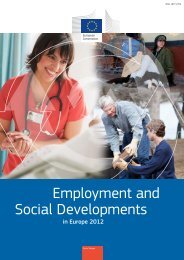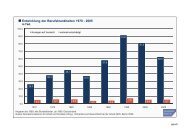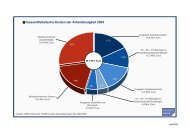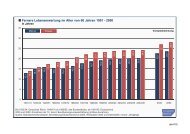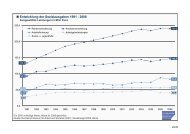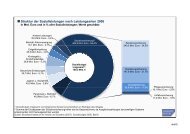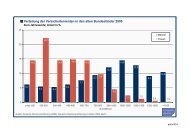Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und ...
Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und ...
Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausschussdrucksache 16(11)538<br />
Ausschuss für Arbeit <strong>und</strong> Soziales<br />
cherte“ vor. Nach § 38 SGB VI n. F. sollen diejenigen<br />
Versicherten Anspruch auf eine Altersrente haben, die<br />
das 65. Lebensjahr vollendet <strong>und</strong> eine Wartezeit <strong>von</strong> 45<br />
Jahren erfüllt haben. Auf die Wartezeit werden nach dem<br />
neuen § 51 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 SGB VI Kalendermonate<br />
mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung<br />
oder Tätigkeit angerechnet. Hierzu zählen etwa auch<br />
Pflichtbeitragszeiten aus nicht erwerbsmäßiger Pflege,<br />
Krankengeldbezug, Wehr- oder Zivildienst sowie aus<br />
Kindererziehung, d. h. aus den ersten drei Jahren der<br />
Erziehung eines Kindes, § 56 Abs. 1 SGB VI. Dagegen<br />
nimmt § 51 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 SGB VI n. F. Pflichtbeitragszeiten<br />
wegen des Bezugs <strong>von</strong> Arbeitslosengeld <strong>und</strong><br />
Arbeitslosengeld II ausdrücklich <strong>von</strong> der Anrechnung<br />
aus. Nach § 51 Abs. 3a Satz 1 Nr. 2 SGB VI n. F. werden<br />
allerdings Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung,<br />
d. h. die ersten zehn Jahre der Erziehung eines<br />
Kindes (§ 57 Satz 1 SGB VI), auf die Wartezeit angerechnet.<br />
Die im Entwurf des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes<br />
vorgesehene Ausnahmevorschrift für besonders<br />
langjährig Versicherte wirft in zweierlei Hinsicht verfassungsrechtliche<br />
Probleme auf. Zum einen könnte eine<br />
verfassungswidrige Ungleichbehandlung verschiedener<br />
Pflichtbeitragszeiten <strong>und</strong> damit verschiedener Versicherter<br />
vorliegen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die<br />
Ausnahmeregelung zu einer mittelbaren Diskriminierung<br />
<strong>von</strong> Frauen führt. Beide Fragen sind vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
der Art. 14 <strong>und</strong> 3 GG zu erörtern.<br />
1. Zum Eigentumsschutz <strong>von</strong> Versichertenansprüchen<br />
<strong>und</strong> -anwartschaften aus der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung<br />
Seit seinem gr<strong>und</strong>legenden Urteil zum Versorgungsausgleich<br />
vom 28. Februar 1980 (BVerfGE 53, 257 ff.) geht<br />
das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung<br />
vom Schutz der Versichertenansprüche <strong>und</strong> -<br />
anwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
durch die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG aus (siehe<br />
BVerfGE 53, 257 [289 f.]; 55, 114 [131]; 58, 81 [109];<br />
64, 87 [97]; 69, 272 [298]; 70, 101 [110]; 95, 143 [160];<br />
100, 1 [32]). Diese Rechtspositionen weisen nach Auffassung<br />
des Gerichts alle konstituierenden Merkmale des<br />
Eigentums im Sinne des Art. 14 GG auf. Regelt der<br />
Gesetzgeber den Leistungsumfang der gesetzlichen Rentenversicherung,<br />
so nimmt er einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit<br />
der Versicherten in Form einer Inhalts- <strong>und</strong><br />
Schrankenbestimmung vor (BVerfGE 53, 257 [293]; 100,<br />
1 [37 f.]). Mit der im Entwurf des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes<br />
vorgesehenen Verkürzung der Rentenbezugsdauer<br />
würde der Gesetzgeber auch den Leistungsumfang<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung reduzieren.<br />
Das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht betont regelmäßig,<br />
Eingriffe in die Eigentumsfreiheit müssten auch den<br />
übrigen Verfassungsvorgaben, insbesondere dem Gleichheitssatz<br />
genügen. Es sieht in der Beachtung des Gleichheitssatzes<br />
ein besonderes Rechtfertigungserfordernis für<br />
Eingriffe in die Eigentumsfreiheit (BVerfGE 70, 191<br />
[200]; 72, 66 [78]; 79, 174 [198]; 87, 114 [139]; 102, 1<br />
[17]).<br />
2. Zur ungleichen Würdigung verschiedener Pflichtbeitragszeiten<br />
a) Ungleichbehandlung <strong>von</strong> wesentlich Gleichem<br />
Gemäß Art. 3 Abs. 1 GG sind alle Menschen vor dem<br />
Gesetz gleich. Ein Verstoß gegen den allgemeinen<br />
Gleichheitssatz setzt eine Ungleichbehandlung <strong>von</strong> wesentlich<br />
Gleichem voraus. Zur Ermittlung dessen sind<br />
Vergleichspaare zu bilden. Eine Ungleichbehandlung<br />
liegt vor, wenn die diese Vergleichspaare bildenden<br />
Personen mit unterschiedlichen Rechtsfolgen belegt<br />
werden. Maßgeblich für die Frage, ob „wesentlich Gleiches“<br />
ungleich behandelt wird, ist nicht jede oder gar die<br />
umfassende Vergleichbarkeit der die Vergleichsgruppe<br />
bildenden Personen, sondern nur deren wesentliche Vergleichbarkeit<br />
hinsichtlich desjenigen Vergleichskriteriums,<br />
das für den Anlass der ungleich wirkenden Behandlung<br />
maßgeblich ist, hierzu also in engem inneren Sachzusammenhang<br />
steht (näher dazu Helge Sodan/Jan Ziekow,<br />
Gr<strong>und</strong>kurs Öffentliches Recht, 2005, § 30 Rn. 9 ff.).<br />
Die Ausnahmeregelung des § 38 SGB VI n. F. behandelt<br />
einzelne Versichertengruppen unterschiedlich. Solche<br />
Versicherten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben <strong>und</strong><br />
bereits 45 Versicherungsjahre im Sinne des § 51 Abs. 3a<br />
SGB VI aufweisen, können danach sofort abschlagsfrei<br />
eine Altersrente beziehen. Der jeweilige Barwert ihrer<br />
Renten erhöht sich dadurch nicht unwesentlich: Die<br />
betroffenen Versicherten kommen nicht nur früher in den<br />
Genuss ihrer Rentenansprüche, sondern beziehen auch<br />
im für sie günstigsten Fall zwei Jahre länger ihre Renten.<br />
Der Tod des einzelnen Versicherten verschiebt sich nämlich<br />
nicht mit dem Renteneintritt. Andere Versicherte, die<br />
zum selben Zeitpunkt weniger als 45 Versicherungsjahre<br />
zurückgelegt haben, aber dieselbe Anzahl <strong>von</strong> Entgeltpunkten<br />
vorweisen können, da sie im Laufe ihrer Versicherungsbiographie<br />
eine höhere Beitragsleistung erbracht<br />
haben, besitzen dagegen erst mit der Vollendung des 67.<br />
Lebensjahres einen Anspruch auf eine abschlagsfreie<br />
Rentenleistung. Trotz gleicher Summe <strong>von</strong> Entgeltpunkten<br />
werden also verschieden hohe Rentenleistungen<br />
gewährt. Dabei bestimmen die Entgeltpunkte die „Rangstelle“<br />
des Versicherten innerhalb der Versichertengemeinschaft<br />
(siehe BVerfGE 54, 11 [28]; Franz Ruland,<br />
Die Sparmaßnahmen im Rentenrecht <strong>und</strong> der Eigentumsschutz<br />
<strong>von</strong> Renten, in: DRV 1997, S. 94 [103]); sie sind<br />
– obgleich sie auch für beitragsfreie Zeiten erzielt werden<br />
(§ 71 SGB VI) – vor allem Ausdruck der individuellen<br />
Beitragsleistung des einzelnen Versicherten, die sich<br />
auch in einer entsprechenden Würdigung auf der Leistungsseite<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung widerspiegeln<br />
muss. Man spricht insoweit vielfach vom Teilhabeäquivalenzprinzip<br />
(siehe Stellungnahme der Deutschen<br />
Rentenversicherung B<strong>und</strong> zum RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz,<br />
2007, S. 8, 11; Gutachten des Sozialbeirats<br />
zum Rentenversicherungsbericht 2006, BT-<br />
Drucks. 16/3700, S. 82; vgl. auch BSGE 90, 11 [23]).<br />
Entscheidet sich der Versicherte, ohne 45 Versicherungsjahre<br />
vorweisen zu können, dennoch für den Renteneintritt<br />
mit 65 Jahren, so muss er Abschläge in Höhe <strong>von</strong> 0,3<br />
% pro Monat, also insgesamt <strong>von</strong> 7,2 % hinnehmen, § 36<br />
Satz 2 SGB VI n. F. in Verbindung mit § 77 Abs. 2 Satz<br />
1 Nr. 2 Buchst. a SGB VI. Diese Abschläge dienen dem<br />
Ausgleich der verlängerten Rentenbezugsdauer. In diesem<br />
Fall wird die Ungleichbehandlung verschiedener<br />
Versichertengruppen besonders deutlich.<br />
Bei den verschiedenen Versichertengruppen handelt es<br />
sich auch um „wesentlich Gleiche“ im Sinne der anerkannten<br />
Dogmatik zu Art. 3 Abs. 1 GG: Beide Versichertengruppen<br />
nehmen an der solidarischen, gesetzlichen<br />
Altersvorsorge teil <strong>und</strong> weisen die gleiche Summe an<br />
Entgeltpunkten auf.<br />
86