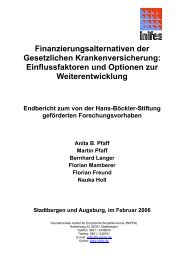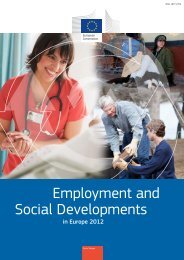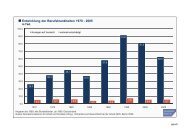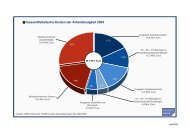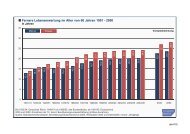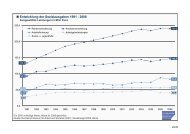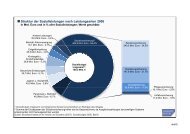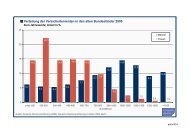Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und ...
Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und ...
Schriftliche Stellungnahmen von Verbänden und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausschussdrucksache 16(11)538<br />
Ausschuss für Arbeit <strong>und</strong> Soziales<br />
Viertel der mit der Reduzierung der Rentenbezugsdauer<br />
möglichen finanziellen Entlastung der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
(Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht<br />
2006, BT-Drucks. 16/3700,<br />
S. 82; vgl. ferner Kalamkas Kaldybajewa/Reinhold Thiede,<br />
Abschlagsfreier vorzeitiger Rentenbeginn für langjährig<br />
Versicherte?, DAngVers 2004, S. 497 [502]).<br />
Die finanziellen Belastungen hätten die Beitragszahler<br />
<strong>und</strong> solche Versicherten zu tragen, denen der Renteneintritt<br />
mit der Vollendung des 65. Lebensjahres verwehrt<br />
bliebe: Versicherte, die zeitweise kammerpflichtigen<br />
Berufen oder einer selbständigen Tätigkeit nachgegangen<br />
sind, ferner Versicherte, die besonders lange Ausbildungen<br />
absolvieren mussten, also insbesondere solche mit<br />
Hochschulabschluss (denn Zeiten der Ausbildung werden<br />
bei der Berechnung der Wartezeit nach § 51 Abs. 3a Satz<br />
1 Nr. 1 SGB VI n. F. nicht berücksichtigt, da es sich<br />
insoweit um Anrechnungszeiten nach § 58 Abs. 1 Satz 1<br />
Nr. 4 SGB VI handelt), <strong>und</strong> nicht zuletzt Versicherte, die<br />
in unsicheren Arbeitsmärkten tätig sind (vgl. Herbert<br />
Rische, Aktuelle Reformdikussionen in der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung, DRV 2006, S. 670 [674]). § 51<br />
Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 SGB VI n. F. nimmt ausdrücklich<br />
Pflichtbeitragszeiten, in denen Versicherte Arbeitslosengeld<br />
bzw. Arbeitslosengeld II bezogen, <strong>von</strong> der Berücksichtigung<br />
als Wartezeit aus, obwohl zu Gunsten der<br />
Versicherten auch in diesen Zeiten Beiträge <strong>von</strong> den<br />
zuständigen Leistungsträgern bzw. durch den B<strong>und</strong> gezahlt<br />
werden (§ 170 Abs. 1 Nr. 1 <strong>und</strong> 2 Buchst. b SGB<br />
VI). Arbeitslosigkeit trifft Arbeitnehmer/innen in vielen<br />
Fällen unverschuldet. Dennoch belohnt das Gesetzesvorhaben<br />
nur Arbeitnehmer/innen in sicheren Arbeitsmärkten,<br />
insbesondere im öffentlichen Dienst, d. h. nur (selektiv)<br />
Leistung, jedoch nicht auch Leistungsbereitschaft.<br />
Insgesamt stellt die Ausnahmevorschrift des § 38 SGB<br />
VI n. F. solche Versicherte besser, die aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
lückenlosen Versichertenbiographie ohnehin über verhältnismäßig<br />
hohe Rentenansprüche verfügen. Deren<br />
besondere soziale Schutzbedürftigkeit ist jedoch äußerst<br />
zweifelhaft.<br />
3. Zur mittelbaren Diskriminierung <strong>von</strong> Frauen<br />
Jedenfalls verfassungsrechtlich bedenklich erweist sich<br />
das Gesetzesvorhaben unter dem Gesichtspunkt der<br />
Gleichbehandlung der Geschlechter. Art. 3 Abs. 2 <strong>und</strong> 3<br />
GG enthalten spezielle Gleichheitssätze, die im Rahmen<br />
ihrer Anwendungsbereiche dem allgemeinen Gleichheitssatz<br />
des Art. 3 Abs. 1 GG vorgehen. Sie verbieten Ungleichbehandlungen<br />
aufgr<strong>und</strong> der speziellen, in ihnen<br />
genannten Merkmale (Geschlecht, Abstammung, Rasse<br />
etc.). Ihre besondere Bedeutung gegenüber dem allgemeinen<br />
Gleichheitssatz besteht vor allem darin, dass<br />
Ungleichbehandlungen aufgr<strong>und</strong> der in ihnen aufgeführten<br />
Merkmale zumindest im Gr<strong>und</strong>satz gerade nicht<br />
durch einen „sachlichen Gr<strong>und</strong>“ gerechtfertigt werden<br />
können. Die speziellen Gleichheitssätze verbieten jedenfalls<br />
die finale, d. h. die ziel- <strong>und</strong> zweckgerichtet auf<br />
eines der betreffenden Merkmale bezogene Diskriminierung<br />
bzw. Privilegierung, nach überwiegender Ansicht<br />
überdies jede Ungleichbehandlung, welche kausal an<br />
eines der betreffenden Merkmale anknüpft, auch wenn<br />
die Maßnahme in erster Linie andere Ziele verfolgt<br />
(BVerfGE 85, 191 [206 f.]; 97, 35 [43]; vgl. auch<br />
BVerfGE 89, 276 [288 f.]; anders [nur finale Diskriminierung]<br />
noch BVerfGE 75, 40 [70]).<br />
Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Var. 1 GG verbietet ausdrücklich<br />
Ungleichbehandlungen aufgr<strong>und</strong> des Geschlechts, statuiert<br />
also ein diesbezügliches Diskriminierungs- <strong>und</strong> Privilegierungsverbot<br />
sowie ein entsprechendes Abwehrrecht.<br />
Erfasst werden auch so genannte mittelbare (indirekte)<br />
Diskriminierungen, d. h. Regelungen, welche zwar geschlechtsneutral<br />
formuliert sind, aber aufgr<strong>und</strong> natürlicher<br />
oder gesellschaftlicher Unterschiede überwiegend<br />
nur ein Geschlecht betreffen (BVerfGE 104, 373 [393];<br />
vgl. auch BVerfGE 97, 35 [43] m. w. N). Über verfassungsimmanente<br />
Rechtfertigungen hinaus können geschlechtsspezifische<br />
Ungleichbehandlungen nur dann<br />
zulässig sein, „soweit sie zur Lösung <strong>von</strong> Problemen, die<br />
ihrer Natur nach nur entweder bei Männern oder bei<br />
Frauen auftreten können, zwingend erforderlich sind“<br />
(BVerfGE 85, 191 [207]; vgl. auch BVerfGE 92, 91<br />
[109]). Daraus folgt, dass allein biologisch begründete<br />
Unterschiede zwischen den Geschlechtern Berücksichtigung<br />
finden dürfen, nicht auch rein „funktionale“, welche<br />
aus traditionellen Rollenverständnissen resultieren.<br />
Deren Verfestigung soll insbesondere Art. 3 Abs. 2 Satz<br />
2 GG entgegen wirken: Danach fördert der Staat die<br />
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung <strong>von</strong><br />
Frauen <strong>und</strong> Männern <strong>und</strong> wirkt auf die Beseitigung bestehender<br />
Nachteile ein.<br />
Die Ausnahmeregelung des § 38 SGB VI n. F. stellt nicht<br />
auf das Geschlecht der Versicherten ab. Eine unmittelbare<br />
Diskriminierung <strong>von</strong> Frauen liegt daher nicht vor.<br />
Auch ist dem Gesetzgeber nicht die Absicht zu unterstellen,<br />
mit der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig<br />
Versicherte Frauen zu diskriminieren. Jedoch lässt<br />
eine Auswertung der Deutschen Rentenversicherung<br />
B<strong>und</strong> darauf schließen, dass vor allem Männer <strong>von</strong> der<br />
Ausnahmeregelung profitieren werden. Datengr<strong>und</strong>lage<br />
der Auswertung waren die Rentenzugangsdaten des<br />
Jahres 2004 sowie die Sondererhebungen Vollendete<br />
Versichertenleben (VVL) desselben Jahres. Im Jahre<br />
2004 hätten danach 33,13 % der männlichen, aber nur<br />
10,99 % der weiblichen Versicherten bei Renteneintritt<br />
45 Versicherungsjahre im Sinne des § 51 Abs. 3a SGB<br />
VI n. F. vorweisen können (Kalamkas Kaldybajewa/Edgar<br />
Kruse, Eine neue vorgezogene, abschlagsfreie<br />
Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45<br />
„Versicherungsjahren“?, RVAktuell 2006, S. 434 [443]).<br />
Dabei ist zu beachten, dass der Gesetzentwurf zu den auf<br />
die Wartezeit anzurechnenden Versicherungszeiten sogar<br />
die Berücksichtigungszeiten, also die ersten zehn Jahre<br />
der Kindererziehung, § 57 Satz 1 SGB VI, zählt (§ 51<br />
Abs. 3a Satz 1 Nr. 2 SGB VI n. F.). Das geschlechtsspezifische<br />
Missverhältnis wird daher zum Teil gemildert.<br />
Keine Berücksichtigung finden jedoch weiterhin die<br />
Erziehungsleistungen derjenigen Mütter, die ihre Kinder<br />
auch über das zehnte Lebensjahr hinaus betreuen. Dasselbe<br />
gilt für Zeiten, in denen wegen Schwangerschaft<br />
oder Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem<br />
Mutterschutzgesetz eine versicherte Beschäftigung oder<br />
selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt wird. Denn insoweit<br />
handelt es sich lediglich um Anrechnungszeiten im<br />
Sinne des § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI, d. h. nicht<br />
um Pflichtbeitragszeiten, sondern um beitragsfreie Zeiten<br />
gemäß § 54 Abs. 4 SGB VI.<br />
Dieser Bef<strong>und</strong> erscheint auch <strong>und</strong> gerade vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
der Rechtsprechung des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts<br />
bedenklich. In einem der am 3. April 2001 verkündeten<br />
Urteile zur Pflegeversicherung nahm das B<strong>und</strong>es-<br />
88