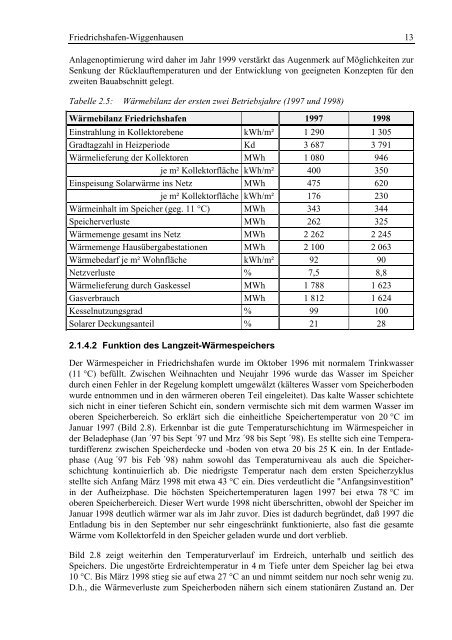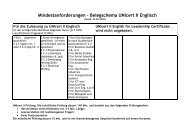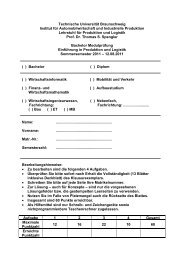download - Technische Universität Braunschweig
download - Technische Universität Braunschweig
download - Technische Universität Braunschweig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Friedrichshafen-Wiggenhausen 13<br />
Anlagenoptimierung wird daher im Jahr 1999 verstärkt das Augenmerk auf Möglichkeiten zur<br />
Senkung der Rücklauftemperaturen und der Entwicklung von geeigneten Konzepten für den<br />
zweiten Bauabschnitt gelegt.<br />
Tabelle 2.5: Wärmebilanz der ersten zwei Betriebsjahre (1997 und 1998)<br />
Wärmebilanz Friedrichshafen 1997 1998<br />
Einstrahlung in Kollektorebene kWh/m² 1 290 1 305<br />
Gradtagzahl in Heizperiode Kd 3 687 3 791<br />
Wärmelieferung der Kollektoren MWh 1 080 946<br />
je m² Kollektorfläche kWh/m² 400 350<br />
Einspeisung Solarwärme ins Netz MWh 475 620<br />
je m² Kollektorfläche kWh/m² 176 230<br />
Wärmeinhalt im Speicher (geg. 11 °C) MWh 343 344<br />
Speicherverluste MWh 262 325<br />
Wärmemenge gesamt ins Netz MWh 2 262 2 245<br />
Wärmemenge Hausübergabestationen MWh 2 100 2 063<br />
Wärmebedarf je m² Wohnfläche kWh/m² 92 90<br />
Netzverluste % 7,5 8,8<br />
Wärmelieferung durch Gaskessel MWh 1 788 1 623<br />
Gasverbrauch MWh 1 812 1 624<br />
Kesselnutzungsgrad % 99 100<br />
Solarer Deckungsanteil % 21 28<br />
2.1.4.2 Funktion des Langzeit-Wärmespeichers<br />
Der Wärmespeicher in Friedrichshafen wurde im Oktober 1996 mit normalem Trinkwasser<br />
(11 °C) befüllt. Zwischen Weihnachten und Neujahr 1996 wurde das Wasser im Speicher<br />
durch einen Fehler in der Regelung komplett umgewälzt (kälteres Wasser vom Speicherboden<br />
wurde entnommen und in den wärmeren oberen Teil eingeleitet). Das kalte Wasser schichtete<br />
sich nicht in einer tieferen Schicht ein, sondern vermischte sich mit dem warmen Wasser im<br />
oberen Speicherbereich. So erklärt sich die einheitliche Speichertemperatur von 20 °C im<br />
Januar 1997 (Bild 2.8). Erkennbar ist die gute Temperaturschichtung im Wärmespeicher in<br />
der Beladephase (Jan ´97 bis Sept ´97 und Mrz ´98 bis Sept ´98). Es stellte sich eine Temperaturdifferenz<br />
zwischen Speicherdecke und -boden von etwa 20 bis 25 K ein. In der Entladephase<br />
(Aug ´97 bis Feb ´98) nahm sowohl das Temperaturniveau als auch die Speicherschichtung<br />
kontinuierlich ab. Die niedrigste Temperatur nach dem ersten Speicherzyklus<br />
stellte sich Anfang März 1998 mit etwa 43 °C ein. Dies verdeutlicht die "Anfangsinvestition"<br />
in der Aufheizphase. Die höchsten Speichertemperaturen lagen 1997 bei etwa 78 °C im<br />
oberen Speicherbereich. Dieser Wert wurde 1998 nicht überschritten, obwohl der Speicher im<br />
Januar 1998 deutlich wärmer war als im Jahr zuvor. Dies ist dadurch begründet, daß 1997 die<br />
Entladung bis in den September nur sehr eingeschränkt funktionierte, also fast die gesamte<br />
Wärme vom Kollektorfeld in den Speicher geladen wurde und dort verblieb.<br />
Bild 2.8 zeigt weiterhin den Temperaturverlauf im Erdreich, unterhalb und seitlich des<br />
Speichers. Die ungestörte Erdreichtemperatur in 4 m Tiefe unter dem Speicher lag bei etwa<br />
10 °C. Bis März 1998 stieg sie auf etwa 27 °C an und nimmt seitdem nur noch sehr wenig zu.<br />
D.h., die Wärmeverluste zum Speicherboden nähern sich einem stationären Zustand an. Der