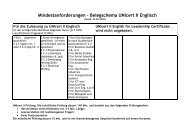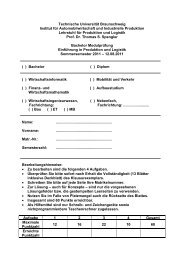download - Technische Universität Braunschweig
download - Technische Universität Braunschweig
download - Technische Universität Braunschweig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
64 Weiterentwicklung der Langzeit-Wärmespeicher<br />
Bausektor übliches Wärmedämmverbundsystem eingesetzt. Die Steinlamellenplatten (120 cm<br />
x 20 cm x 20 cm) wurden mittels Baukleber an der Betonwand befestigt (siehe Bild 3.8). Die<br />
Wärmedämmung wurde mit einer Armierung aus Glasfasergewebe und einer wasserabweisenden<br />
Mörtelschicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Durch eine Noppenfolie und<br />
eine vorgestellte Drainplatte wird eventuell auftretendes Niederschlagswasser drainiert.<br />
3.1.2.6 Be- und Entladeeinrichtung<br />
Die Heißwasser-Wärmespeicher werden als Verdrängungsspeicher betrieben, d.h. bei Einbringen<br />
von Wasser wird dieselbe Masse gleichzeitig wieder dem Wärmespeicher entzogen.<br />
Um eine gute Temperaturschichtung im Wärmespeicher zu erzielen, wird das heiße Wasser<br />
oben knapp unter dem Wasserspiegel eingebracht, während kaltes Wasser in Bodennähe<br />
entzogen wird. Beim Entladen wird umgekehrt verfahren, d.h. warmes Wasser wird oben<br />
entzogen, während kaltes Rücklaufwasser aus dem Wärmeverteilnetz unten nachfließt. Dies<br />
bedeutet, daß die oberen und unteren Einbauten abwechselnd zum Be- und Entladen genutzt<br />
werden müssen.<br />
In Abhängigkeit vom geplanten Volumenstrom sind die Be- und Entladeeinrichtungen (im<br />
folgenden auch Ladewechseleinrichtungen genannt) auszulegen. Um Turbulenzen und damit<br />
eine Vermischung des Speicherwassers zu verhindern, müssen die Strömungsgeschwindigkeiten<br />
klein gehalten werden (kleiner als 0,1 m/s). Dies begünstigt dünne Temperaturübergangsschichten.<br />
Zusätzlich muß für eine möglichst horizontale Zu- oder Abströmung<br />
gesorgt werden /27/.<br />
Bauformen solcher Ladewechseleinrichtungen enthalten kleine Auslaßöffnungen in Form von<br />
Schlitzen oder Bohrungen. Es sind aus früheren Untersuchungen /28/ bekannt: Schlitzauslässe<br />
(mit und ohne Diffusor), Doppelrohrauslässe und Radialauslässe.<br />
Je nach Betriebsweise des Speichers treten bei der Auslegung der Ladewechseleinrichtungen<br />
unterschiedliche Probleme auf. So ist bei der Kurzzeit-Wärmespeicherung meist ein hoher<br />
Massenstrom auf einer relativ kleinen Speicheroberfläche zu verteilen. Eine vermischungsarme<br />
Zuströmung ist hier viel schwieriger als bei der Langzeit-Wärmespeicherung, bei der die<br />
Verhältnisse genau umgekehrt sind und eher die gleichmäßige Beschickung über die gesamte<br />
Speicheroberfläche zu Problemen führt.<br />
Aufgrund des fertigungstechnischen Aufwandes sind kreisförmige Doppelrohrausführung mit<br />
den vielen notwendigen Bohrungen nicht zu empfehlen. Radialauslässe sind für alle Speicher<br />
geeignet und unter wirtschaftlichen Bedingungen gut herstellbar. Durch einfach zu variierende<br />
Größen wie Durchmesser und Spalthöhe scheinen sie am besten geeignet. Durch mehrere<br />
dieser Auslässe ist auch eine gleichmäßige Zuströmung über die gesamte Speicheroberfläche<br />
gewährleistet.<br />
Die Verrohrung im Wärmespeicher ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. In langen Rohrleitungen<br />
im Speicher, die quer zu allen Temperaturschichten verlegt sind, findet ein Wärmetransport<br />
statt. Dieser führt zum Abbau der Schichtung im Wärmespeicher und zu einer<br />
ungewollten Temperaturänderung des Be- bzw. Entlademassenstroms. Somit wird der Speichernutzungsgrad<br />
reduziert.